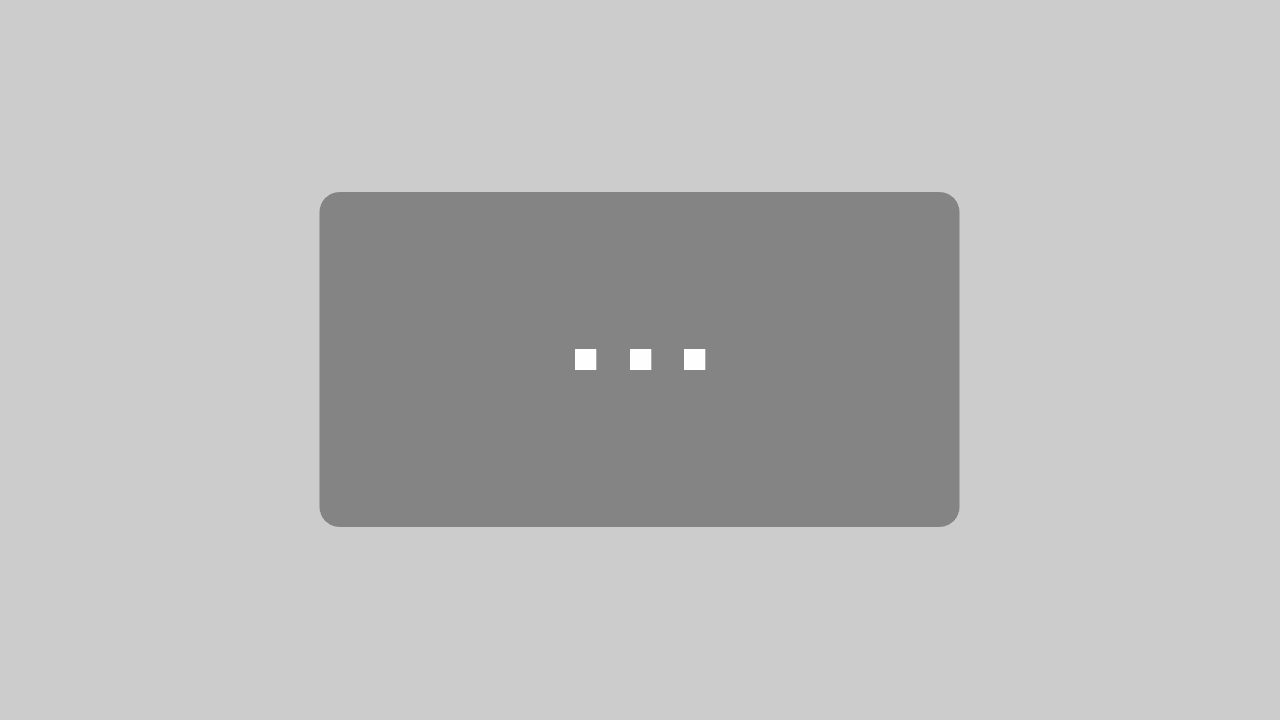Der Meister und Margarita
Sa 06.09.2025 | 19:30 Uhr
R/KRO 25, R: Michael Lockshin, FSK: 12, 156 min
Kneipe mit kleinem Speisenangebot ab 18 Uhr
Moskau in den 1930er-Jahren. Ein bekannter russischer Schriftsteller und sein Theaterstück über Pontius Pilatus geraten in die Mühlen des stalinistischen Überwachungsstaates. Die Premiere seines Theaterstücks wird abgesagt. Inspiriert von seiner Geliebten Margarita beginnt er mit der Arbeit an einem neuen Roman, in welchem er sämtliche Menschen aus seinem realen Leben in satirisch überspitzter Gestalt auftreten lässt. Im Mittelpunkt steht Woland (grandios: August Diehl), eine mystisch-dunkle Macht, die Moskau besucht, um sich an all jenen zu rächen, die für den Ruin des Autors verantwortlich sind. Während der Meister, wie dieser sich fortan nennt, immer tiefer in seine Geschichte eintaucht, vermag er allmählich nicht mehr zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden …
»Ein faszinierendes Spiel mit Realität und Kunst auf mehreren Erzählebenen, ein opulenter Bilderrausch und großes Kino für den Kopf, das auch das Herz mitnimmt!« CINEMA
Die opulente Neuverfilmung des legendären Romans von Michail Bulgakow (für einige Kritiker der beste russische Roman des 20. Jahrhunderts), verknüpft die Romanhandlung und das Leben des in Kiew geborenen Schriftstellers miteinander. Die sinnlich-humorvolle Satire auf Stalinismus, Zensur und hierarchische Inkompetenz entpuppt sich (auch) als beißende Kritik an den aktuellen Zuständen in Russland. Gedreht vor dem Einmarsch in die Ukraine, wurde der Film über das Lieblingsbuch vieler Russen großzügig staatlich gefördert. Als nach dem Erscheinen des Films der Regisseur sich unterstützend für die Ukraine äußerte, wurden Forderungen nach einem Verbot laut. Allerdings zeigten da die russischen Kinos den Film schon bis zu zehnmal am Tag – vor ausverkauften Häusern.
„Jede Form der Macht ist Gewalt an anderen“ – Mit diesen Worten beschrieb der russische Autor und Satiriker Michail Bulgakow (1891–1940) die Essenz seines bekanntesten Romans DER MEISTER UND MARGARITA. Geschrieben über den Verlauf von zwölf Jahren, diktierte er seiner Frau die letzte Fassung noch auf dem Sterbebett, im sicheren Wissen, dass es das Werk niemals an den strengen Zensurbehörden der UdSSR vorbei schaffen würde. Zu direkt und pointiert war die Kritik am sowjetischen Staatsapparat, an Zensur, Unterdrückung und Propaganda. Geschrieben hat er es dennoch, denn „veröffentlichen muss ein Schriftsteller nicht, aber schreiben … schreiben muss er!“
»Überbordend, exzentrisch, exzessiv – die subversive Verfilmung eines subversiven Romans und der erfolgreiche Flug unter dem Radar der russischen Zensur – ein Teufelswerk!«
Es ist nicht der erste Versuch, Michail Bulgakows gleichnamigen Roman zu verfilmen, zweifellos aber einer der besten. Visuell anspruchsvoll interpretiert der russisch-amerikanische Filmemacher die Geschichte und scheut sich nicht vor Anspielungen auf die Gegenwart (dass es sich 2025 merkwürdig anfühlen könnte, dass der Moskau niederbrennende Teufel ausgerechnet aus Deutschland kommt, konnte Bulgakov in den 1930ern nicht ahnen). Der Film wurde vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine gedreht, Lokshin überwachte den Schnitt aus dem Exil und konnte nur aus der Ferne erleben, wie sein Werk 2024 ein Millionenpublikum in den russischen Kinos erreichte. Putins Anhänger gingen auf die Barrikaden, als hätten sie jetzt erst bemerkt, dass Bulgakov eine beißende Satire über autoritäre Regime geschrieben hatte. Eine vielschichtige Vorlage, kreativ und opulent inszeniert von bizarren Fantasy-Elementen bis zu philosophischen Exkursen, mit einem exzellenter Schauspielensemble – ein herausragendes, hochkarätiges Literaturepos zur richtigen Zeit!
Der Film läuft auch am Mi 10.09. | 19:30 Uhr im Kronenkino Zittau.
Pressestimmen zum Film:
Der Meister und Margarita
Von Barbara Schweizerhof / epd film
Michael Lockshin, in den USA geborener Regisseur mit russisch-amerikanischen Wurzeln, hat Michail Bulgakows Roman adaptiert. Seine als Parabel über intellektuelle Feigheit lesbare Version wurde in Russland 2024 zum Publikumshit
Michail Bulgakows Roman »Der Meister und Margarita« hat eine außergewöhnliche Rezeptionsgeschichte: Geschrieben in den 1930er Jahren, wurde er erst Mitte der 60er Jahre, über 25 Jahre nach dem Tod des Autors, publiziert – und erlangte in der Sowjetunion augenblicklich Kultstatus. Die facettenreiche Form des Romans, der Satire, fantastisch-spirituelle Elemente, Philosophie-Traktat und politischen Kommentar miteinander verbindet, lässt vielerlei, auch widersprüchliche Interpretationen zu und gilt als schwer verfilmbar. Andrzej Wajda beschränkte sich in seinem 1971 fürs ZDF produzierten Fernsehfilm »Pilatus und andere« auf den in Jerusalem spielenden Teil der Erzählung. Andere Adaptionen, wie etwa Yuri Karas mit russischen Stars und einem Score von Alfred Schnittke hochkarätig besetzte Version von 1994, fanden wegen juristischer und anderer Dispute nie ihr Publikum. Ein Schicksal, das Michael Lockshins im Jahr 2021 gedrehte Verfilmung fast auch ereilt hätte: Der 1981 in den USA geborene Regisseur mit russisch-amerikanischen Vorfahren war nach Drehschluss in die USA zurückgekehrt, von wo er sich lautstark gegen den Überfall Russlands auf die Ukraine äußerte. In Russland konnte der Film unter Anfeindungen erst im Januar 2024 ins Kino kommen, entpuppte sich dann aber als regelrechter Publikumshit.
Dabei hat Lockshin seine Adaption keineswegs besonders an aktuelle Verhältnisse angepasst: Wie der Roman spielt auch der Film im Moskau der 1930er Jahre, das die digital verstärkte Ausstattung hier als erfüllten Traum futuristischer Architektur malt. Das Theaterstück des »Meisters« (Evgeniy Tsyganov) über Pontius Pilatus wurde gerade abgesetzt, er selbst wird aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen, begegnet aber Margarita (Yuliya Snigir), die ihn als Geliebte und Muse zur Arbeit an einem Roman anstiftet, in dem er einen Teufel namens Woland (August Diehl) samt Entourage in Moskau sein Unwesen treiben lässt. Oder ist Letzteres die eigentliche Realität? Und den eloquenten Herrn Woland, der eines Tages so nonchalant am Ufer des Patriarchenteichs auftaucht und dem kläglichen Vorsitzenden des Schriftstellerverbands MASSOLIT seine baldige Enthauptung vorhersagt, weil »Annushka das Öl schon verschüttet hat«, gibt es wirklich? Mit teuflischer Häme und bösen Tricks führen er und seine Gefolgschaft, zu der ein sprechender Kater namens Behemoth gehört, den Opportunismus, die Korruption und vor allem die Feigheit der Intellektuellen dieser Zeit vor Augen, kulminierend in einem regelrechten Hexenball, der sich aber genauso als Kritik an Konsumgier lesen lässt.
Der Film wechselt die Zeitebenen – eine davon zeigt den Meister in einer Irrenanstalt, eine andere den von Claes Bang gespielten Pontius Pilatus – und berührt Themen wie Zensur, die Natur von Gut und Böse, die Macht der Liebe und der Kunst. Wie schon im Roman ist das alles ein bisschen viel, und wie es dem Roman entspricht, entzieht sich auch Lockshins Adaption den einfachen Erklärungen. Auch das passt in unsere Zeit.
Ein subversiver Klassiker?
Von Hannah Wagner/ Abendzeitung München
Die russische Neuverfilmung von „Der Meister und Margarita“ hat ein Kriegsgegner gedreht. Kremltreue sind entsetzt, doch die Menschen strömen in die Kinos
Eigentlich hatte alles recht harmlos angefangen: Michail Bulgakows Literaturklassiker „Der Meister und Margarita“ sollte verfilmt werden – wieder einmal. Es war 2021, Russlands Krieg gegen die Ukraine hatte noch nicht begonnen. Der staatliche russische Kinofonds hatte zugesagt, die Dreharbeiten mit 800 Millionen Rubel (8 Millionen Euro) zu unterstützen. Monate vor der Premiere wurde das Projekt in Moskauer Kinos groß beworben.
Doch dann erschien der Film Ende Januar – und das Entsetzen bei Putin-treuen war groß. Denn der Regisseur des Films, der in den USA lebende Regisseur Michail Lokschin, fand unterstützende Worte für die Ukraine. In propagandistischen russischen Telegram-kanälen wurde Lokschin als „glühender Russophober“ und als „Proukrainer“ bepöbelt. Der kremlnahe Autor Sachar Prilepin schimpfte, ihm werde mit Blick auf die staatliche Mitfinanzierung „übel“. Schnell wurden Forderungen laut, den Film zu verbieten, um Lokschin keine Bühne zu bieten. Doch dafür war es zu spät: Filmspielhäuser zeigen „Der Meister und Margarita“ teils zehnmal pro Tag, immer wieder sind die Vorstellungen ausverkauft. Seine enormen Produktionskosten in Höhe von 1,2 Milliarden Rubel (12 Millionen Euro) hat der Film längst eingespielt.
Ein Grund für die Begeisterung dürfte sein, dass nach knapp zwei Jahren sanktionsbedingter Filmflaute wieder Blockbuster auf der Leinwand zu sehen ist, und dann ist es auch die Verfilmung des Lieblingsbuches vieler Russen.Doch hinter dem Erfolg von Lokschins Werk steckt wohl noch etwas anderes: nämlich, dass der Regisseur Bulgakows Meisterwerk in einer Art verfilmte, die durchaus auch als kritisch gegenüber Kremlchef Wladimir Putins Machtapparat verstanden werden kann.
Im Original ist der Roman „Der Meister und Margarita“, den Bulgakow kurz vor seinem Tod 1940 fertig schrieb, eine beißende und unterhaltsame Satire auf das Zensursystem unter Josef Stalin (1879-1953). Das Buch handelt von einem namenlosen „Meister“, der eine Erzählung über die biblische Figur Pontius Pilatus schreiben will, das aber angesichts des staatlich verordneten Atheismus nicht darf. Daraufhin schließen der Meister und seine Geliebte Margarita einen Pakt mit dem Teufelin Gestalt des mysteriösen Zaubermeisters Voland, der Vertreter des Staatsapparats schikaniert. „Der Meister und Margarita“ ist dabei nicht nur ein Buch über Stalinsche Zensur, sondern auch selbst Opfer dieser gewesen: Veröffentlicht werden konnte das Werk erst Jahre nach Bulgakows Tod und das auch nur in gekürzter Form. In voller Länge erschien es in der Sowjetunion erst im Jahr 1973.
Filmregisseur Lokschin hat nun beide Stränge – die Romanhandlung und die Biografie des Schriftstellers – miteinander verwoben. Der von Jewgeni Zyganow gespielte Protagonist ist fiktiver Meister und historischer Bulgakow in einem. Heraus kommt dabei ein doppelt düsteres Werk über staatliche Repression, Denunziantentum und die daraus resultierende Verzweiflung. Schon die Hetzjagd gegen den Meister durch seine Schriftstellerkollegen zu Beginn des Films ist so anschaulich, dass es beim Zuschauen bedrückt. In den gut zweieinhalb Stunden, in denen der Meister nach und nach den Verstand verliert, entsteht ein Gefühl der Beklemmung.
Vor allem sehen viele Zuschauer in Lokschins Werk nicht nur die Grauen der sowjetischen Vergangenheit abgebildet, sondern auch Parallelen zum heutigen Russland. „Der Film sei vollgepackt mit brandaktuellen Bildern und Hinweisen“, meint der bekannte russische Filmkritiker Anton Dolin. Die Teufelsfigur – verkörpert vom deutschen Schauspieler August Diehl – erinnere ihn an einen „ausländischen Agenten“, schreibt er mit Blick darauf, dass Russlands Machtapparat unter dieser Bezeichnung derzeit Kritiker und Oppositionelle brandmarkt. „Die Jagd auf den Meister ist eine Furcht einflößende Nachbildung der Mechanismen, die in der russischen Kultur in letzter Zeit zur Normalität geworden sind“, schreibt Dolin im kremlkritischen Portal „Meduza“ weiter. Er spielt damit auf die vielen repressiven Gesetze an, die seit Kriegsbeginn erlassen wurden. So steht mittlerweile die vermeintliche Diskreditierung der russischen Armee ebenso unter Strafe wie die Darstellung homosexueller Liebe und anderer queerer Inhalte.
Dass der Film trotzdem in den russischen Kinos läuft, wird mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Die kremlkritische Zeitung „Nowaja Gaseta“ findet, der Film sei ein „Messer in den Rücken der russischen Propaganda“. Und Regisseur Lokschin selbst bezeichnete es Us-medien zufolge als „Wunder“, dass sein Werk in diesen Zeiten überhaupt herausgekommen sei. Einige Beobachter erklären sich das mit den immensen Produktionskosten, die zurück erwirtschaftet werden mussten. Andere verweisen darauf, dass eine Verbannung dieses Klassikers aus den Kinosälen ein noch größerer Skandal wäre, den der Kreml kurz vor der Präsidentenwahl am 17. März nicht gebrauchen könne.