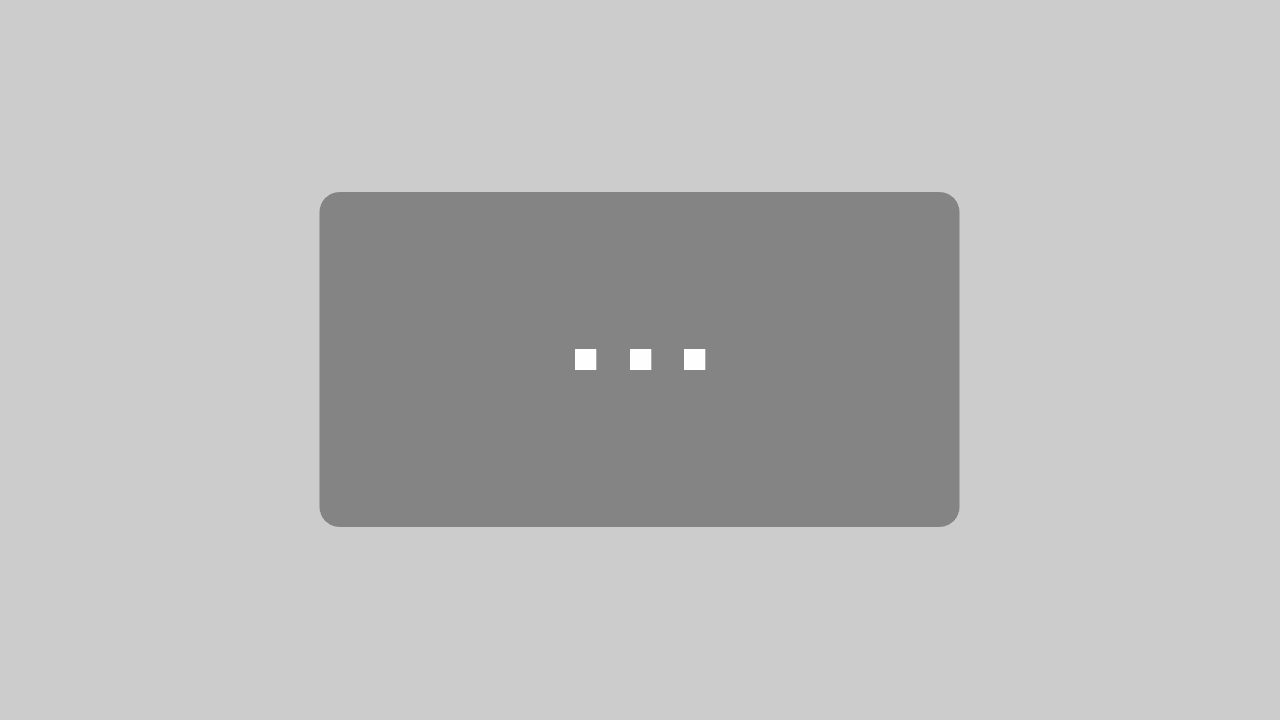Dokfilm: Hollywoodgate – Ein Jahr unter den Taliban
Fr 17.10.2025 | 19:30 Uhr
USA/D 25, R: Ibrahim Nash’at, FSK: 16, 95 min
Kneipe mit kleinem Speisenangebot ab 18 Uhr
Nach dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan im August 2021 ergreifen die Taliban die Kontrolle über eine verlassene US-Militärbasis – und stoßen dort auf ein Arsenal zurückgelassener Waffen im Wert von rund 7 Milliarden US-Dollar. Inmitten dieser historischen Umbruchsituation erhält der Dokumentarfilmer Ibrahim Nash’at exklusiven Zugang und begleitet über ein Jahr hinweg führende Taliban-Kommandeure. Die Kamera dokumentiert minutiös, wie sich die Gruppe vom Bild einer Miliz zu einer modernen Militärmacht stilisieren will – inklusive gezielter Propaganda in Hollywood-Manier. „Hollywoodgate“ ist damit nicht nur eine Beobachtung aus nächster Nähe, sondern auch ein erschütterndes Zeitdokument über Macht, Medieninszenierung und das Erstarken eines Regimes mit beunruhigender Zukunftsperspektive.
Pressestimmen zum Film
Hollywoodgate – Ein Jahr unter den Taliban
(Irene Gernhart, Filmdienst)
Dokumentarische Beobachtungen über das erste Jahr der Taliban-Herrschaft in Afghanistan, die einen unmittelbaren Einblick in die Genese einer Militärdiktatur gewähren.
Wenige Tage, nachdem die Taliban Ende August 2021 die Herrschaft in Afghanistan errungen und die letzten US-Soldaten Kabul verlassen hatten, reiste der Journalist Ibrahim Nash’at nach Afghanistan. Der gebürtige Ägypter hatte sich in den Jahren davor eingehend mit den politischen Führern der Welt beschäftigt. Nun möchte er beobachten, wie sich die Taliban von einer Milizgruppe in eine islamistische Regierung transformieren, die fundamentalistischen Vorstellungen anhängt.
Was die Taliban erlauben
Dank seiner guten journalistischen Kontakte gelingt es ihm relativ leicht, ins Land einzureisen. Er kommt mit dem jungen Talibankämpfer Mutkhatar in Kontakt, der auf eine Militärkarriere hofft. Aber auch mit dem frisch zum Chef der Luftwaffe beorderten Mawlawi Mansour. Beide gestatten ihm, sie im Rahmen der von den Taliban diktierten Bedingungen zu filmen. Konkret bedeutet dies, dass Nash’at ausschließlich Taliban filmen darf und er die Kamera ausschalten muss, sobald sie dies befehlen. Tatsächlich finden sich in „Hollywoodgate“ einige Szenen, in denen Nash’at die Kamera so lange laufen lässt, bis sich ihm jemand nähert und die Linse mit der Hand abdeckt.
Zu Beginn erklärt Nash’at sinngemäß, dass er das zeigen wolle, was die Taliban ihm zeigten. Weit wichtiger aber sei, was er selbst gesehen habe. In „Hollywoodgate“ präsentiert er eine Mischung aus beidem. Vieles erinnert an Bilder, wie man sie aus der Berichterstattung von „Embedded Journalists“ kennt. Nash’at zeigt Dinge, die spürbar für die Kamera inszeniert wurden. Etwa eine Gruppe junger Taliban, die mit hochmodernen Gewehren aus einem aufgelassenen US-Stützpunkt in einer menschenleeren Gegend Schießübungen veranstalten. Oder eine Rede von Mawlawi Mansour, als er auf dem kargen Gelände eines einst von den US-Amerikanern kontrollierten Militärstützpunkts eine Baumpflanzaktion startet, in der er sich in seltsame Faseleien über das Verhältnis von Westlern und ihren Frauen verstrickt.
Aus dem Auto heraus
Nicht alles in „Hollywoodgate“ lässt sich klar verorten. Nash’at, der meist auch die Kamera führte, drehte oft nachts oder filmte aus dem fahrenden Auto heraus. Häufig sieht man Straßenszenen aus Kabul oder von Fahrten ins Hinterland. Einmal zeigen ihm die Taliban in dunkelster Nacht die Höhlen, in denen sie sich in ihren kämpferischen Jahren versteckt hatten. Hin und wieder finden sich Szenen, die in einem Spiegel gefilmt sind, wobei auch Nash’at gelegentlich mit ins Bild gerät.
Nash’at hat Mutkhatar und Mawlawi Mansour ein Jahr lang begleitet. Das erste Mal war er mit der Kamera dabei, als die Taliban im September 2021 die Hallen eines US-Militärstützpunktes inspizierten. Den Titel „Hollywoodgate“ verdankt der Film einem der mit „Hollywood Gate“ beschrifteten Tore. Neben zerstörtem Mobiliar, IT- und Büro-Inventar fanden die Taliban dort ein riesiges Medikamentenlager, Waffen und Munition, Werkzeuge sowie viele Ersatzteile für die im Stützpunkt zurückgelassenen Flugzeuge.
Die Flugzeuge werden flottgemacht
Der Wert des US-Materials wird auf über sieben Milliarden Dollar geschätzt. Als gegen Ende des Films Ärzte das Lager inspizieren, haben viele Medikamente ihr Verfallsdatum überschritten. Die Ersatzteile aber werden genutzt, um die Flugzeuge wieder auf Vordermann zu bringen. Und mit den Waffen rüsteten die Taliban ihre Kämpfer aus. Mansour ist sichtlich stolz, dass er ein Jahr nach der Machtübernahme bei der Jubiläumsfeier die Fliegerflotte vorführen kann. Es ist eine reine Machtdemonstration, an die sich unmittelbar die Forderung knüpft, nun endlich gegen Tadschikistan vorzugehen, das den Feinden der Taliban seit langem Schutz und Herberge gewährt.
Man kann in „Hollywoodgate“ Schritt für Schritt mitverfolgen, wie Mansour an Selbstsicherheit gewinnt und wie Mutkhatar zum Piloten ausgebildet wird. Das Land verwandelt sich in dieser Zeit in ein Militärregime, das auch dank der US-Army über ein ziemlich modernes Waffenarsenal verfügt.
Man stößt aber auch auf einige Vignetten anderen Inhalts. Sie zeigen splitterhaft quirlige Straßenszenen. Autos, Marktstände, Männer und Frauen. Es gibt Aufnahmen von Handgemengen und Querelen, aber auch eine Szene, in der Männer Burka-tragende Frauen in aller Öffentlichkeit auspeitschen. Ob der Soldat, der einer vor ihm auf dem Boden knienden Frau ein Gewehr an den Hinterkopf hält, den Abzug betätigt, erfährt man nicht, weil die Szene unmittelbar geschnitten ist.
Ein quälendes Zeitdokument
Ibrahim Nash’at hat „Hollwoodgate“ vom September 2021 bis zum September 2022 gefilmt. Es ist eine Momentaufnahme und ein rares Zeitdokument. Von ihm ausgehend wäre über vieles zu sprechen, was im Film nur kurz aufblitzt oder unterschwellig mitschwingt. Etwa darüber, dass eine Frau diesen Film vermutlich nie hätte drehen können. Oder über die fatale Arroganz fundamentalistisch agierender Machtinhaber, die sich immer im Recht glauben. Über ihre krude Missachtung der Menschenrechte und die Ignoranz gegenüber allem, was man als human bezeichnet. Und die schamlose Herabwürdigung und gewalttätige Unterdrückung der Frauen.
Oder über Dummheit, die mitschwingt, wenn ein junger Taliban sich brüstet, eine Ärztin geheiratet zu haben, die jetzt aber nicht mehr praktiziert, weil er ihr das verboten habe. Dass seine Söhne dereinst gar keine Ärztin mehr heiraten können, weil im Taliban-Staat Mädchen nur noch bis zur sechsten Klasse die Schule besuchen, kommt ihm nicht in den Sinn.
„Hollywoodgate“ ist kein leicht verdaulicher Film. Die Botschaft, die in ihm mitschwingt, ist ein Warnruf vor dem, was sich derzeit weltweit anzubahnen scheint. Vor dem sollte man nicht die Augen verschließen.
„Am meisten überrascht hat mich, wie wenig religiös die Taliban sind“
(Carolin Ströbele, Die Zeit)
Für seinen Dokumentarfilm „Hollywoodgate“ begab sich Ibrahim Nash’at in Lebensgefahr. Hier erzählt der Regisseur, wie er ein Jahr lang eine Taliban-Gruppe begleitete.
Die Aufnahmen verzweifelter Afghaninnen und Afghanen, die sich an Flugzeuge klammerten, um aus dem Land zu fliehen, gingen im Sommer 2021 um die Welt. Nur wenige Tage nach dem überstürzten Abzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan reiste der ägyptische Journalist und Dokumentarfilmer Ibrahim Nash’at nach Kabul und beobachtete mit der Kamera ein Jahr lang, wie eine Gruppe von Taliban eine verlassene Militärbase übernahm. Nun läuft sein viel beachteter Film „Hollywoodgate – Ein Jahr unter den Taliban“ auch in Deutschland. Die ZEIT traf den Regisseur Ende Juli in Berlin.
ZEIT: Ibrahim Nash’at, was hat Sie bewogen, unter solch gefährlichen, lebensbedrohlichen Umständen einen Film zu drehen?
Ibrahim Nash’at: Die Bilder vom Flughafen in Kabul während des Abzugs der Amerikaner – die Menschen, die flohen, die Angst in ihren Augen – das hat mich wirklich tief berührt. Zwei Männer hielten sich an einem Flugzeug fest und stürzten in den Tod. Ich fragte mich: Was bringt jemanden dazu, sich in eine Situation zu begeben, in der er weiß, dass er höchstwahrscheinlich sterben wird? Wenn die Überlebenschance bei vielleicht einem Prozent liegt, und man trotzdem diese Möglichkeit wählt, weil es keine Option ist, im Land zu bleiben.
ZEIT: Sie haben in Ihrem Film ein Jahr lang einen jungen Taliban und seinen Vorgesetzten, den Oberbefehlshaber der afghanischen Luftwaffe, dabei begleitet, wie sie eine verlassene US-Militärbasis entdecken. Man sieht, wie sich eine Truppe verarmter Kämpfer in eine schwer bewaffnete militärische und politische Macht verwandelt. Wie haben Sie das Vertrauen der Taliban gewonnen?
Nash’at: Von Vertrauen kann man nicht wirklich sprechen. Ich weiß nicht, ob sie mir jemals vertraut haben – oder ich ihnen. Bis zum letzten Tag haben sie meine Kamera kontrolliert, ob ich vielleicht eine Bombe darin versteckt hätte. Ich glaube, sie dachten eher: Was soll’s, schadet ja nicht, wenn er da ist. Nach dem Abzug der US-Truppen inszenierten sie sich als eine Art Taliban 2.0, behaupteten, sie würden sich für Frauenrechte einsetzen. Sie wollten sich der Weltöffentlichkeit als gemäßigte Bewegung präsentieren. Außerdem schienen sie sehr stolz, dass ein Ausländer ihnen folgte – jemand, der bereits Präsidenten, Vizepräsidenten und Premierminister begleitet hatte.
ZEIT: Sie standen ständig unter der Kontrolle der Taliban, umgeben von schwer bewaffneten Männern. Wie sind Sie mit dem Druck und der psychischen Anspannung umgegangen?
Ibrahim Nash’at, geboren 1990, wuchs in Ägypten auf und besuchte später die Met Film School in London. Er arbeitete als Journalist für Al Jazeera, Business Insider, Voice of America und die Deutsche Welle. Sein Dokumentarfilm „Hollywoodgate“ feierte 2023 in Venedig Premiere, war auf der Shortlist für den Dokumentarfilm-Oscar und nominiert für den Deutschen Filmpreis.
Nash’at: Es war beängstigend, mein Körper hat das erst später verarbeitet. Ich glaube, das Gehirn versucht in solchen Momenten eher Gemeinsamkeiten mit den Menschen zu finden, statt sich auf das Bedrohliche zu fokussieren. In dem Moment des Filmens haben mich das Adrenalin und der Wille gesteuert, diese Geschichte weiterzuerzählen. Ich hatte das Gefühl, ich müsste etwas für die Afghanen tun. Der Zugang, den wir bekommen hatten – den niemand sonst hatte – bedeutete auch eine moralische Verpflichtung für mich. Wir wollten das zeigen, was sonst nie gezeigt wird – die Grauzonen, in denen man versteht, wie Afghanistan tatsächlich funktioniert.
ZEIT: Was hat Sie in dieser Zeit am meisten überrascht?
Nash‘at: Am meisten hat mich überrascht, wie wenig religiös die Taliban sind. Sie nutzen religiöse Titel, wollen die Scharia umsetzen, aber viele von ihnen wissen gar nicht, was das wirklich bedeutet. In einer Szene geht es darum, dass Moderatorinnen erstmals einen Gesichtsschleier im Fernsehen tragen sollten. Da sagte ein Taliban: „Ich hoffe, das widerspricht nicht dem islamischen Gesetz.“ Das zeigt: Sie setzen Regeln durch, deren Bedeutung ihre eigenen Leute gar nicht kennen. Religion und Waffen sind für sie Mittel zum Zweck, um Macht zu erlangen.
ZEIT: Sie selbst sind in Ägypten in einer religiösen muslimischen Familie aufgewachsen. Konnten Sie mit den Taliban über Religion sprechen?
Nash’at: Ich habe anfangs versucht, mit einigen von ihnen zu sprechen – und das hat mich in Gefahr gebracht. Manche Kämpfer wiederholten, was ich gesagt hatte, und wurden gefragt: „Woher hast du diese fremden Ideen?“ – „Von Ibrahim.“ – Dann kamen die Anführer zu mir und sagten: „Wenn du noch einmal so mit unseren Männern sprichst, wirst du verschwinden.“
ZEIT: Wie haben Sie darauf reagiert?
Nash’at: Ich habe mich zurückgenommen und beobachtet. Mein Job war es, die Realität zu dokumentieren, nicht zu diskutieren oder Meinungen zu ändern.
Hollywoodgate – Ein Jahr unter den Taliban (Cinema)
Die preisgekrönte Doku zeigt in unkommentierten Bildern das Innenleben und Denken der Taliban.
Kurz nach dem Abzug der amerikanischen Truppen im August 2021 macht sich Ibrahim Nash’at, ein in Berlin lebender ägyptischer Journalist, auf den Weg nach Afghanistan. Ein Jahr lang wird er den Luftwaffenoffizier Mawlawi Mansour mit der Kamera begleiten. Er ist dabei, wenn die neuen Machthaber den US-Stützpunkt (mit Fitnessraum) inspizieren, die Taliban Aktionen gegen Widerstandskämpfer planen oder das „Bataillon der Selbstmordbomber“ an einer Militärparade teilnimmt.
Nash’at weiß wohl selbst nicht so genau, warum die Taliban ihn gewähren lassen. Die Bilder zeigen nur, was er filmen durfte, das tägliche Leid der afghanischen Zivilbevölkerung gehört nicht dazu. Man ahnt, dass er selbst in Lebensgefahr schwebte, denn die Taliban wittern überall Spione und machen kurzen Prozess mit ihren Widersachern. „Der kleine Teufel filmt wieder“, beschwert sich einer im Hintergrund – und es klingt wie eine Drohung. „Hollywoodgate“ wirft einen entlarvenden Blick hinter „die obszöne Macht derer, die den Krieg anbeten“, so das ernüchternde Fazit des Regisseurs am Ende seines Films.