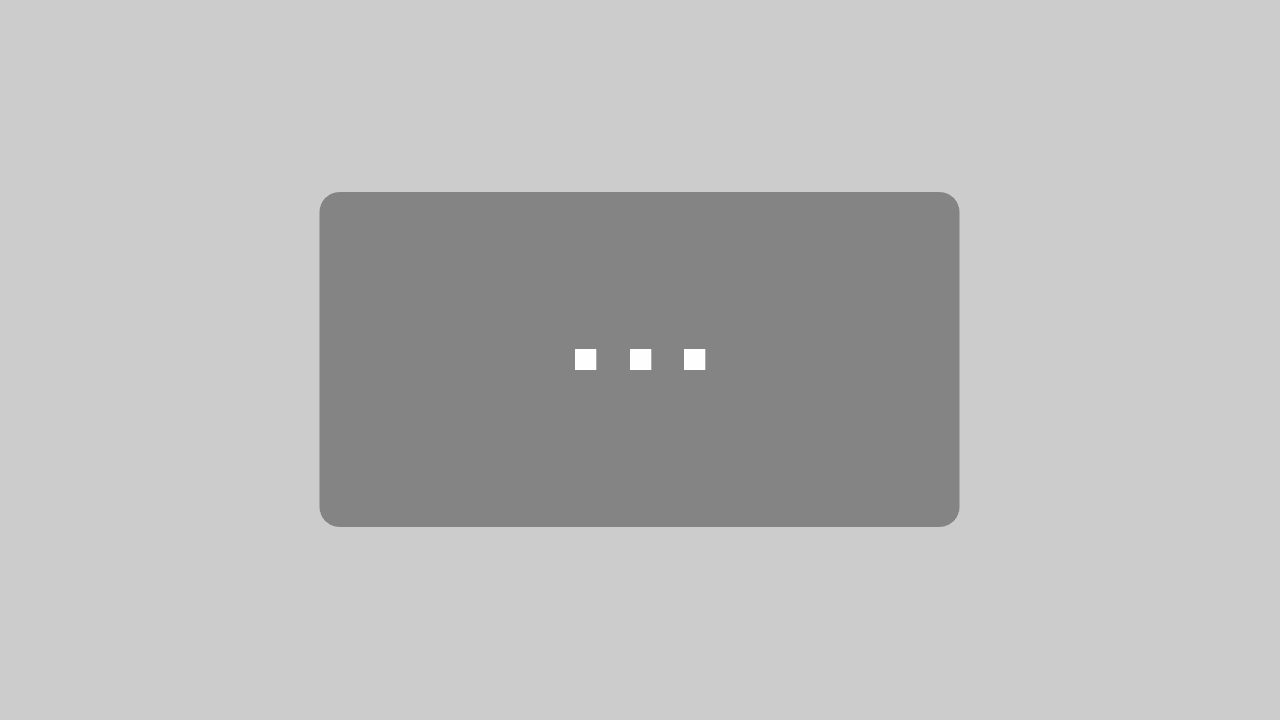Köln 75
Sa 25.10.2025 | 19:30 Uhr
D/B 24, R: Ido Fluk, FSK: 12, 112 min
Kneipe mit kleinem Speisenangebot ab 18 Uhr
KÖLN 75 erzählt die mitreißende und wahre Geschichte der rebellischen 18-jährigen Vera Brandes (Mala Emde), die selbstbewusst und leidenschaftlich alles aufs Spiel setzt, um ihren Traum zu verwirklichen. Gegen den Willen ihrer konservativen Eltern bucht sie auf eigenes Risiko das Kölner Opernhaus, um Keith Jarrett (John Magaro) im Januar 1975 für ein Konzert nach Köln zu holen.
Sie weiß es noch nicht, aber diese improvisierte Stunde am Klavier, die bis zuletzt zu scheitern droht, wird auf Schallplatte verewigt und von vielen als eines der populärsten Kunstwerke des 20. Jahrhunderts angesehen: Keith Jarretts „The Köln Concert“.
Der Film läuft auch am Mi 29.10. | 19:30 Uhr im Kronenkino Zittau.
Pressestimmen zum Film
Köln 75 (Ulrich Kriest, Filmdienst)
Augenzwinkernde Historienkomödie um die jugendliche Organisatorin von Keith Jarretts legendärem „Köln Concert“ in den 1970er-Jahren.
Wenig liebt die konservative Jazz-Community mehr als all die Anekdoten und Mystifikationen, die über ihre Helden und (weitaus seltener) Heldinnen und deren Meisterwerke kursieren. Dazu gehört auch die vielfach kolportierte, äußerst schwierige Entstehungsgeschichte rund um Keith Jarretts legendäres, kommerziell höchst erfolgreiches und doch vom Künstler selbst wenig geschätztes „Köln Concert“. Was Jarrett am späten Abend des 24. Januar 1975 auf der Bühne der ausverkauften Kölner Oper an einem minderwertigen und nur notdürftig reparierten Stutzflügel widerfuhr, geriet in der Folge zu einer Verdichtung des Zeitgeistes, der als Parfüm der Mittsiebziger, des Post-Revolutionären und der Neuen Innerlichkeit von Robert Wilson („Death, Destruction, and Detroit“) bis Nanni Moretti („Liebes Tagebuch“) zuverlässig abgerufen werden konnte.
Derart reich an Anekdoten sind dieses Konzert und sein Zustandekommen, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie zum Filmstoff werden würden. Mit „Köln 75“ von Ido Fluk hat es nun 50 Jahre gedauert. Regisseur und Drehbuchautor Fluk beschränkt sich pragmatisch auf die Vorgeschichte des Konzerts, kommt zudem ohne einen Ton der bekannten Musik von Keith Jarrett aus und verschiebt die Perspektive in gut Brecht’scher Manier vom Künstler-Genie auf diejenigen, die es ermöglichen. Diejenigen, die die Bühnen bereiten, die die Klaviere stimmen, die die Schallplatten produzieren, die den Tourbus fahren. Und nicht als faktenseriöses Doku-Drama, sondern eher augenzwinkernd als Märchen. Gralshütern der Jazz-Geschichte mag das eine Prise Ironie zu viel sein, erfrischender und unterhaltsamer als das üblich gewordene Re-Enactment von längst Bekanntem ist es allemal.
Jugend und Jazz
Ido Fluk behauptet: So könnte es gewesen sein. Es war einmal ein britischer Jazzmusiker mit Namen Ronnie Scott, der gastierte so um 1971 mit seinem Trio im legendären Kölner Eis-Café von Gigi Campi. Bei dieser Gelegenheit lernt Scott die kecke, selbstbewusste und quirlige Vera Brandes (Mala Emde) kennen, die sich aus unerfindlichen Gründen trotz ihrer Jugend für die „Museumsmusik“ Jazz begeistert. Beeindruckt von Brandes’ Temperament, beauftragte Scott die Teenagerin Vera, ihm eine Tour zu buchen, weil, so der Musiker, ihr niemand etwas abschlagen könne. Völlig unerfahren entscheidet sich Vera neben der Schule für „Learning by Doing“, hierbei heimlich auf das Telefon in der väterlichen Zahnarztpraxis zurückgreifend. Nach anfänglichem Scheitern gelingt es Vera tatsächlich, die Tour zu buchen. Ihr Honorar bestärkt sie, am Ball zu bleiben und sich improvisierend einen Ruf als Konzertveranstalterin zu erarbeiten.
Schon 1974 kann sie die Konzertreihe „New Jazz in Cologne“ mit Jazzgrößen wie Oregon, Pork Pie und Gary Burton auf die Beine stellen. Das finale, fünfte Konzert der Reihe soll ein Solo-Auftritt von Keith Jarrett (John Magaro) sein, der Brandes als Solist auf den „Berliner Jazztagen“ begeistert hat. Um ein Late-Night-Konzert in der Kölner Oper zu veranstalten, geht Brandes mit der Saalmiete mit subversiver Hilfe der Mutter (Jördis Triebel) in persönliche Vorleistung und setzt buchstäblich ihre Zukunft aufs Spiel. Dass das Konzert am 24. Januar 1975 unter widrigsten Bedingungen überhaupt stattfindet, verdankt sich wohl unter anderem der Tatsache, dass Ronnie Scott in seiner Einschätzung des Charismas und der Kondition von Vera Brandes richtiggelegen hat. Denn je näher der Zeitpunkt des Konzertbeginns rückt, desto mehr gerät „Köln 75“ zu „Vera rennt“. Hier noch ein kurzer Besuch beim WDR, um Werbung für das Konzert zu machen, dann die Suche am Freitagnachmittag nach dem Verbleib des versprochenen Flügels, nach einem vollwertigen Ersatzinstrument, nach Klavierstimmern sowie die Straßenwerbung per Handzettel.
Ein minderwertiger Flügel als Chance
In der entscheidenden Szene des Films weist die improvisierende Konzertveranstalterin das zuverlässig hadernde Improvisationsgenie Keith Jarrett darauf hin, dass gerade der minderwertige Flügel eine Chance sei, sein Improvisationstalent zu beweisen. Und vielleicht, so steht zu vermuten, ist es gerade Jarretts kreativer Umgang mit den klanglichen Limitationen des Flügels, der zu den Hitqualitäten des „Köln Concert“ geführt hat. Gerade im direkten Vergleich zu anderen dokumentierten Solo-Auftritten Jarretts, die deutlich avancierter ausfallen.
Im Gegensatz zum Publikum, das sich ins „Köln Concert“ verliebte, war Jarrett selbst von seiner Leistung enttäuscht. Nur konsequent, dass er seine Musik für den Film nicht freigegeben hat. Was bedauerlich ist, aber dem Film selbst keinen Abbruch tut, weil der Beginn des Konzerts das Ende des Films bezeichnet. Vera Brandes hat gerackert und gerackert und wird schließlich belohnt. Wie das Kölner Publikum und nicht zuletzt das Label „ECM“, das einen Megaseller serviert bekam.
„Köln 75“ ist also kein Jazzfilm, sondern eine teilweise rasante, mit der Aufhebung der vierten Wand spielende Komödie über Improvisation und Selbstermächtigung, die viel Schwung aus der antiautoritären Revolte von 1968 mitgenommen hat. Wenn schon nicht Jarrett zu hören ist im Film, so aber doch Avantgarde-Rock von Can und Polit-Rock von Floh de Cologne. Die jugendliche Clique, LSD und die Neue Frauenbewegung liefern das Hintergrundrauschen. Ein zentraler Konflikt des Films könnte die Variation eines „Ton Steine Scherben“-Songs sein: „Ich will nicht werden, was mein Alter ist“. Den Karrierevorstellungen ihres Vaters (Ulrich Tukur), einem Patriarchen alter Schule, entspricht der Job als Konzertveranstalterin nun ganz und gar nicht. Er sieht Vera eher als Zahnärztin, Diplomatin oder Richterin. Und dass sie noch nicht einmal zwanzigjährig der Lokalpresse bereits als „alter Jazzhase“ gilt, macht die Sache nicht einfacher. Vom Vater wird sie als Hure beschimpft. Eine Rahmenhandlung stellt zudem klar, dass die Enttäuschung des Vaters auch Jahrzehnte später nicht verpufft ist.
Die Vision von freier Improvisation
Obschon Vera Brandes im Fokus des Films steht, gibt es auch noch eine Nebenhandlung in „Köln 75“, die um Keith Jarrett und seine Vision von freier Improvisation kreist. Das Kölner Konzert war das fünfte im Rahmen einer elftägigen Europatournee Jarretts als Solist. Am Abend vor Köln spielte er in Lausanne, am folgenden Abend in Baden in der Schweiz. Begleitet vom Musikproduzenten und „ECM“-Labelchef Manfred Eicher und einem (fiktiven) fantasievollen Jazz-Journalisten (Michael Chernus), dem ein Interview mit dem wortkargen Künstler versprochen wurde, bewältigt das Trio in einem R4 hunderte Kilometer zwischen den Auftrittsorten. Diese Road-Movie-Atmosphäre mit Rückenschmerzen, Übermüdung, Selbstausbeutung und weitgehend befolgtem Schweigegebot nutzt der Film trotzdem, um die erstrebte Voraussetzungslosigkeit der freien Improvisation zu skizzieren. Auch ist für ein Kurzreferat über Improvisation im Jazz und in der Klassik Zeit. Und nicht zuletzt hat sich Alexander Scheer den bekannten Duktus Manfred Eichers angeeignet, was sein Spiel zu einem ganz besonderen Vergnügen macht. Scheer nutzt hier eine weitere Gelegenheit, sein Kabinett gespielter Pop-Ikonen zu erweitern.
„Köln 75“ hat allerlei Überraschungen in petto, mit denen nicht zu rechnen war. Und das „Köln Concert“ kann man sich schließlich nach dem Kinobesuch zuhause selbst auflegen. Ist übrigens nicht so toll. Da hat Keith Jarrett Recht.
Das Höllen-Konzert (Tobi Müller, DIE ZEIT)
Eine Musikkomödie – fast ohne Jazz. Der Film „Köln 75“ erzählt die Vorgeschichte zu Keith Jarretts „Köln Concert“ aus Sicht der jungen Veranstalterin.
Die ersten fünf Töne der bis heute meistverkauften Solo-Platte kennen die meisten Menschen, ob sie es wollten oder nicht. Keith Jarrett steuert mit einer Melodie auf nur weißen Tasten einen Moll-Akkord an, das Hallpedal ist runtergedrückt. In diesem einfachen Dreiklang, mit dem das im Januar 1975 aufgenommene The Köln Concert beginnt, erholen sich die Siebzigerjahre vom gescheiterten Anspruch der gesellschaftlichen Erneuerung. Jarrett hatte zu dem Zeitpunkt ein paar Jahre Solokonzerte hinter sich, in denen er US-amerikanischen Folk, den Kontrapunkt von Bach und die komplexe Rhythmik des Jazz improvisierend kreuzte wie keiner vor oder nach ihm. Die Kölner Aufnahme ist ein, Pardon für die Phrase, Meilenstein der Musikgeschichte.
Das Bild auf dem ikonischen Plattencover, das Jarrett konzentriert und mit geneigtem Kopf am Flügel zeigt, sieht man erst kurz vor Ende des Films Köln 75 von Ido Fluk. Aber man hört nicht die berühmte Tonfolge, die der Komponist vom Pausengong der Oper abgewandelt hat. Nein, der Soundtrack spielt To Love Somebody von den Bee Gees in der Version von Nina Simone. Ein Schock. Die Musikauswahl ist zum Teil aus der Not geboren: Der Film durfte die Aufnahme nicht verwenden und auch sonst nichts von Keith Jarrett. Es ist aber auch inhaltlich konsequent: Denn es geht in Köln 75 nicht in erster Linie um den Künstler, sondern um die junge Frau, die seinen Auftritt möglich gemacht hatte.
Knapp zwei Filmstunden arbeitet die erst 18-jährige, überforderte, überschäumende und hartnäckige Veranstalterin Vera Brandes (Mala Emde) auf diesen Moment hin. Es ist ihre Geschichte, ihr Film. Keith, in Köln, volles Haus: Das Hippiemädchen, das Jazz statt Rock hört, hat es geschafft. Aber kein Ton vom Köln Concert. „You don’t know what it means to love somebody“ könnten auch die Worte sein, die Vera ihrem Vater entgegenschmettert, dem strengen Zahnarzt, von Ulrich Tukur als Fiesling gespielt.
Künstliche Intelligenz ist die wichtigste Technologie unserer Zeit. Aber auch ein riesiger Hype. Wie man echte Durchbrüche von hohlen Versprechungen unterscheidet, lesen Sie in unserem KI-Newsletter.
Dieser Vater hatte als Junge die Scheinwerfer auf den Nachthimmel über Köln gerichtet, um der deutschen Flugabwehr die alliierten Bomber anzuleuchten. Sein Trauma bewältigt er nun, indem er dem ausgehenden Wirtschaftswunder wehtut, das bei ihm auf dem Zahnarztstuhl sitzt. Die Praxis liegt im Keller des Eigenheims, einem Wohlstandsbunker, in dem die Mutter (Jördis Triebel) aus Protest schon zum Frühstück raucht. Der Sohn hasst alle. Die Tochter attackiert mit kurzem Wildlederrock und radikaler Liebe – für die Musik. Vera hat zwar einen Freund, aber verknallt ist sie in den Jazz, die Wunderwaffe gegen alle Spießer.
Köln 75 ist eine Geschichte der Emanzipation, ein Coming-of-Age-Film über eine junge Frau. Er erzählt viel von Flower-Power und Emanzipation im wieder erstarkten Westdeutschland und blickt gleichzeitig durch die Brille heutiger Geschlechtervorstellungen auf die Seventies. Vera dominiert ihre Clique, die jungen Männer bleiben Kulisse. Die Schauspielerin Mala Emde verkörpert den Lebenshunger und die Musikverliebtheit ihrer Figur in jedem Bild mit viel Körperspannung.
Früh im Film wird der Voyeurismus abmoderiert, der in der Konstellation junges Mädchen – ältere Jazzmänner lauert. Als Vera und ihre Freundin Isa (Shirin Lilly Eissa) in einem Jazzclub den britischen Saxofonisten Ronnie Scott sehen, befürchtet man schon, dass der alte Mann die junge Frau mit seiner Star-Power verführen will. Vera ist da noch 16, posiert als 25, die beiden essen spätnachts Eis. Und als sie schon denkt, dass er sie ins Hotel bitten wird, sagt er etwas ganz anderes: „Buch mir eine Tournee durch Deutschland.“ – „Warum ich?“, fragt Vera. – „Weil dich niemand ablehnen kann.“ Schnell geschnitten und lustig gespielt sind die ersten Booking-Versuche der Schülerin, die nachts aus der Zahnarztpraxis heimlich telefoniert (Anrufe waren teuer, Kinder!), und, als die ersten Gigs stehen, schnellstens von zu Hause auszieht.
Die legendäre nächtliche Fahrt im R 4 von Lausanne nach Köln
Der Regisseur und Drehbuchautor Ido Fluk kann wunderbar und leichtfüßig über die tiefe Liebe zum Jazz erzählen, ohne Leute zu verschrecken, die bei diesem Stichwort sonst sofort den Notausgang suchen. Nur manchmal übertreibt er es etwas: Als Vera Keith Jarrett (John Magaro) zum ersten Mal spielen sieht, ist das Licht schwer dunkelblau, die Kamera holt die schockverliebte Vera direkt ins Bild. Schnitt. Sie trifft ihren Freund, die beiden fallen sofort übereinander her. Der arme Kerl muss als Jarrett-Ersatz herhalten, sagt uns das, oder gleich als Sexobjekt für die Musik überhaupt, die man begehren, aber nicht besitzen kann.
Der Soundtrack an den beiden Stellen, in denen Magaro als Jarrett beim Spiel zu sehen ist, stammt vom Schweizer Pianisten Stefan Rusconi. Der sollte ursprünglich der Kamera nur seine grazilen Hände auf der Tastatur leihen, schrieb dann aber gleich neue Pianoparts. Die Anmutung von Jarretts Musik gelingt, aber die Lücke, kein Original spielen zu dürfen, bleibt. Die Comedy-Elemente des Films helfen, sie zu kitten.
Dann etwa, als Köln 75 für längere Zeit den Schauplatz wechselt und Jarrett, seinen Fahrer und Musikproduzenten Manfred Eicher (Alexander Scheer) und einen US-amerikanischen Musikjournalisten (Michael Chernus) auf der legendären nächtlichen Fahrt in der Blechkiste eines zitronengelben Renault 4 von Lausanne nach Köln begleitet.
In dieser Nacht findet der Film einen neuen Ton, der sich aus dem Kontrast zwischen dem massigen Journalisten auf der kleinen Rückbank (eine Erfindung, die der Film auch als solche preisgibt) und Scheers ruhigem Manfred-Eicher-Porträt ergibt. Nebenbei erfährt man, dass der Jazz 1975 schon kaputt war, weil die großen US-Labels von Jarrett unablässig neue Platten mit Standards verlangten. Mit seinen Solokonzerten rebellierte Jarrett dagegen und fand bei Eichers Münchner Label Zuflucht. Vor dem Großerfolg der Köln-Aufnahme bedeutete diese Freiheit aber selbst für einen Künstler wie ihn: keine Flüge, keine guten Hotels, kein gutes Essen.
Den Rest der Geschichte kennt zumindest in Köln jedes Kind ab 50 Jahren. Die junge Veranstalterin Vera Brandes bekam zwar die Oper als Veranstaltungsort für Jarrett, aber erst ab 23 Uhr. Und der Flügel, der parat stand, war nicht der vereinbarte, sondern ein Probeninstrument mit weniger Tasten und einem kaputten Pedal. Herrlich, wie Jarrett den kurz anschaut, eine Taste drückt, mit Eicher tuschelt, sich abwendet, während der Produzent die Botschaft überbringt: Darauf wird Keith nicht spielen. Es gibt noch mal Tempo, zwei Klavierstimmer treten als komisches Paar auf, und dann gibt es noch eine Ansprache von Veras Bruder. Wie Vera dann schließlich Jarrett überzeugt, trotz aller Widrigkeiten zu spielen, ist nicht nur toll geschrieben und gespielt, sondern auch schlau gebaut, weil John Magaro als Jarrett nie eine komplette Reaktion, nie eine Entwicklung ganz ausspielen muss. Das Augenmerk bleibt auf Brandes.
Völlig zu Recht. Denn, wie der US-Journalist einmal erklärt, dies sei kein Film über Michelangelos Deckenmalereien in der Sixtinischen Kapelle, sondern einer über das Gerüst. Ohne das es das wunderbare Kunstwerk nicht gegeben hätte.
Köln 75 (Michael Meyns, Programmkino.de)
Als Film über einen Konzertflügel könnte man Ido Fluks „Köln 75“ bezeichnen, denn am falschen Instrument wäre fast das legendäre Konzert in Köln gescheitert, mit dem der amerikanische Jazz-Pianist Keith Jarrett endgültig zur Legende wurde. Wie es dazu kam, erzählt Fluk vor allem als Emanzipationsgeschichte – aber leider ohne die Musik Jarretts.
Gerade einmal 16 Jahre jung ist Vera Brandes (Mala Emde) 1973, als sie in Köln beginnt, als Veranstalterin von Jazz-Konzerten zu arbeiten. Eher zufällig hat sie ihre Leidenschaft entdeckt, ihre große Klappe und Unverblümtheit sorgt dafür, dass auch Musiker, die ihre Väter sein könnten, sich von dem Teenager mitreißen lassen.
Brandes wirklicher Vater (Ulrich Tukur), ein spießiger Zahnarzt, der mit seiner Frau (Jördis Triebel) in einer ausladenden, der Zeit entsprechend mit viel Holz getäfelten Wohnung residiert, ist dagegen war alles andere als begeistert von den Ambitionen der Tochter. Etwas richtiges solle die doch lieber lernen, dann könnte sie irgendwann eine Praxis haben und dazu Mann und Kind.
Genau das also, was die lebenslustige Vera Brandes gerade nicht anstrebt. Sie ist fasziniert von der Welt der Musik, besonders dem Jazz. Und so plant sie, am 24. Januar 1975 ein Konzert in der Kölner Oper zu organisieren, bei dem Keith Jarrett (John Magaro) einmal mehr beweisen soll, warum er als ebenso revolutionärer Musiker wie John Coltrane oder Miles Davis gilt.
Manchmal sind Entstehungsgeschichten fast noch besser als das eigentliche Ereignis, im Fall von Keith Jarretts legendärem „Köln Concert“ ist es eher so, dass die Umstände spektakulär, das Ergebnis dagegen eine Sensation waren. Die meistverkaufte Jazz-Platte eines Solo-Künstlers sind die Aufnahme der gut 60 Minuten, die Jarrett Ende Januar in Köln auf der Bühne verbrachte, allein improvisierend und das auf einem grenzwertigen Flügel.
Ganz so heruntergekommen, wie das im Film gezeigte Modell war der Flügel zwar wohl nicht, ansonsten hat Autor und Regisseur Ido Fluk in seinem biographischen Musikfilm „Köln 75“ die Realität aber kaum mythologisieren müssen, um einen oft fesselnden Film zu drehen. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Die Rechte an der Musik von Keith Jarrett und vor allem dem Köln Concert, standen nicht zur Verfügung, die besondere Qualität des musikalischen Ansatzes Jarrett wird dadurch nur aus zweiter Hand deutlich. Was allerdings zur besten Szenen des Films führt: In einer langen Einstellungen führt der zwischenzeitlich als Erzähler fungierende amerikanische Musik-Journalist Michael Watts (Michael Chernus) einmal quer durch die Geschichte des Jazz, vom Big Band-Sound über kontrollierte Improvisationen im Korsett von Standards, zum experimentellen Free Jazz eines Miles Davis, bis hin zum völlig los gelösten Ansatz Keith Jarretts, der versucht, völlig neue, noch nie gehörte Musik zu spielen und das jeden Abend.
Auch John Magaro als Jarrett und Alexander Scheer als dessen Manager Manfred Eicher (der bald danach das Label ECM mitbegründen sollte, bei dem das „Köln Concert“ zum Millionen-Erfolg werden sollte) gelingt es mitreißend, die besondere Qualität Jarretts in Worte zu fassen. So gut gelingt das, dass man bedauern mag, dass in „Köln 75“ nicht Keith Jarrett im Mittelpunkt steht, sondern Vera Brandes, die zwar nach den hier geschilderten Ereignissen eine bemerkenswerte Karriere erlebte, aber im Vergleich zu einem Genie wie Keith Jarrett dann doch etwas blass wirkt. Zumal Ido Fluk sie als kaum fehlbares Wesen schildert, der bloß Kraft ihres Enthusiasmus alles gelingt. Interessant ist diese Geschichte zwar auch, die Qualität von „Köln 75“ liegen allerdings auf anderer Ebene.