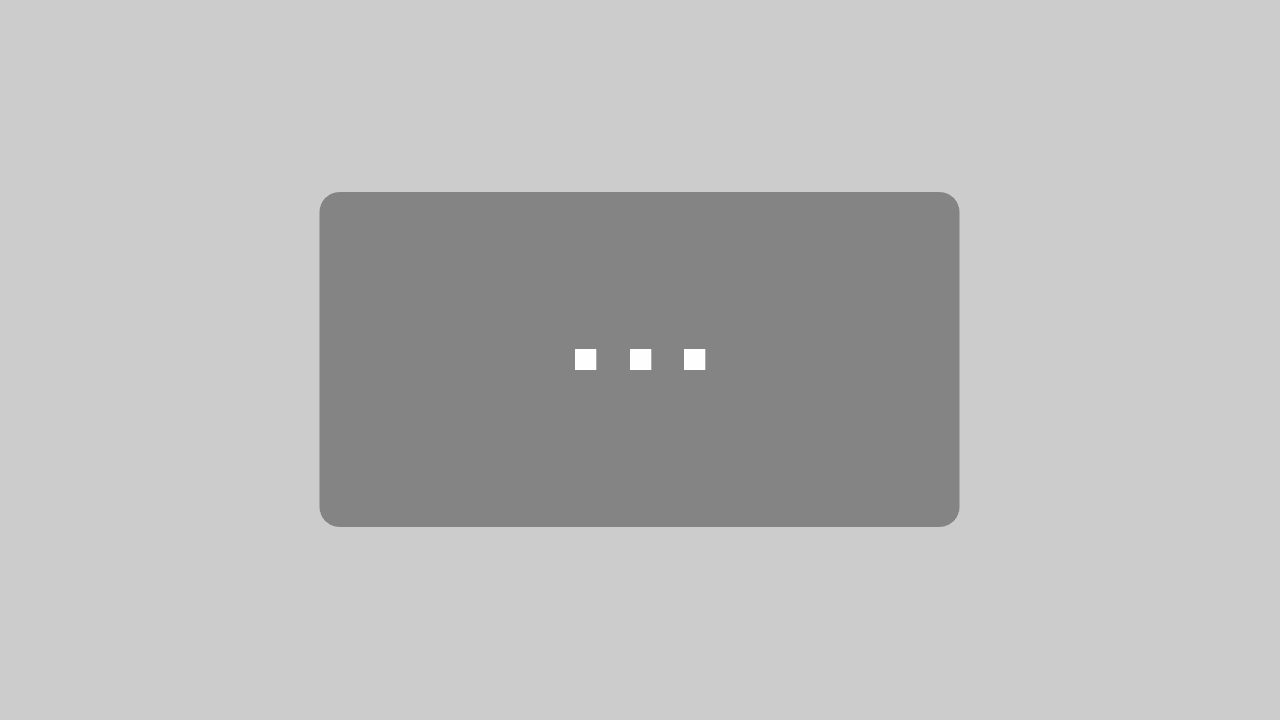Memoiren einer Schnecke
AUS 24, R: Adam Elliot, FSK: 12, 94 min
Kneipe mit kleinem Speisenangebot ab 18 Uhr
+++ ermäßigter Eintritt für alle, die ein Schneckenhaus mitbringen (bitte ohne Schnecke! :-) +++
Regisseur Adam Elliot („Mary & Max – oder: Schrumpfen Schafe, wenn es regnet?“), vielfach ausgezeichneter Animationskünstler, hat viele Jahre an diesem zauberhaften Stop-Motion-Animationsfilm gearbeitet, denn er wurde ganz altmodisch als Knet-Animation in Handarbeit und ohne digitale Effekte produziert. Herausgekommen ist ein kleines Wunderwerk mit unendlichen Einfällen, liebevollen Details und grimmigem Galgenhumor, ein Film über Träume und Ängste, soziale Isolation, Abwehrmechanismen, kreative Freiheit und mutmachende Freundschaft.
„Ein gekneteter Bildungsroman über die Kraft einer Schwachen – einer der besten und bewegendsten Animationsfilme, die ich kenne.“ (Knut Elstermann, radioeins)
Die enthusiastische Schneckensammlerin und Liebesromanleserin Grace Pudel ist ziemlich einsam. Rückblickend erzählt sie der Gartenschnecke Sylvia die Geschichte eines Lebens, das es nicht immer gut mit ihr gemeint hat. Nach dem Tod ihrer Mutter wachsen Grace und ihr Zwillingsbruder Gilbert in den 70er Jahren (wo alles immer irgendwie braun aussieht) bei ihrem querschnittsgelähmten, alkoholkranken Vater auf. Als auch dieser überraschend verstirbt, werden die Geschwister voneinander getrennt und vom Jugendamt in verschiedene Pflegefamilien gesteckt. Kontakt halten sie ausschließlich über Briefe. Während Gilbert am anderen Ende von Australien den Grausamkeiten einer fanatisch-religiösen Familie ausgesetzt ist, zieht sich Grace immer mehr in ihr Inneres zurück – genau wie ihre geliebten Schnecken. Erst durch die Freundschaft mit Pinky, einer exzentrischen älteren Dame voller Lebensfreude, schöpft sie wieder Hoffnung und erkennt, wie schön das Leben trotz all seiner Härte sein kann.
„Wo andere Lebensgeschichten nach dem Großen suchen, fragt Elliot nach dem Kleinen. Er zeigt die Schwächen und die Stärken der Charaktere und erweist sich als feinfühliger, sehr genauer Beobachter mit einer großen Liebe für seine Figuren. Er findet Menschlichkeit und eine Seele, wo eigentlich nur Plastilin ist.“ (filmdienst)
Der Film läuft auch am Mi 05.11. | 19:30 Uhr im Kronenkino Zittau.
Pressestimmen zum Film
Memoiren einer Schnecke (Knut Elstermann, radioeins)
Grace, die Hauptfigur des australischen Animations-Meisterwerks „Memoiren einer Schnecke“, ist eine kleine Heldin der traurigen Gestalt. Ihr Leben erscheint als eine einzige Abfolge von Schicksalsschlägen: Waisenhaus, Trennung vom geliebten Zwillingsbruder, verständnislose Adoptiveltern, brutales Mobbing, Kränkung und Einsamkeit.
Trost sucht sie bei den Schnecken, Einzelgänger wie Grace, die sich in ihre ganz eigene Welt zurückzieht. Schließlich findet sie in der wunderbar exzentrischen alten Pinky sogar eine Freundin, die genau wie sie nach ihren eigenen Regeln lebt.
Ausschließlich im Stop-Motion-Verfahren und in gebauten, düsteren Settings erzählt Oscarpreisträger Adam Elliot unendlich einfallsreich, voller schräger Details und mit grimmigem Witz von einer hässlichen Welt, in der sich die reine Seele Grace durchschlagen muss – ein gekneteter Bildungsroman über die Kraft einer Schwachen, einer der besten und bewegendsten Animationsfilme, die ich kenne.
Wohnt hier die Kunst? (Jens Balzer, Die Zeit)
Acht Jahre lang knetete der Regisseur Adam Elliot für seinen Film „Memoiren einer Schnecke“.
Grace heißt Pudel mit Nachnamen, aber ihre Lieblingstiere sind Schnecken. Seit sie ein Kind ist, sammelt sie Schneckenfiguren, Schnecken aus Ton, Keramik und Porzellan, sie trägt eine selbst gehäkelte Mütze mit Schneckenfühlern, und an den Fühlern befinden sich natürlich Augen, sie lebt in einer Wohnung, die gefüllt ist mit Schnecken, und es ist auch eine Schnecke, der sie in diesem Film von ihrem Leben erzählt, die Schnecke heißt Sylvia. Grace Pudel hat in ihrem Leben viele Schmerzen erlitten, darum wäre sie gerne wie eine Schnecke, die sich bei Gefahr in ihr Haus zurückziehen kann. Die Leidenschaft für Schnecken hat sie von ihrer Mutter ererbt, doch die Mutter starb bei ihrer Geburt, und der Vater, ein französischer Straßenjongleur, der ihrer Mutter aus Liebe nach Australien gefolgt war, stirbt vor Gram, als ihr Zwillingsbruder Gilbert und sie gerade noch Kinder sind. Grace und Gilbert müssen sich trennen, Gilbert wird von einer fundamentalistischen Christenfamilie adoptiert, Grace kommt zu einem Paar, das freilich kurz nach ihrer Ankunft die Freuden des Swingertums entdeckt und sich auf ausgedehnten Sexreisen rund um die Welt verliert. So ist sie allein.
Schnecke Sylvia hat sich also einiges anzuhören, aber Schnecken sind geduldig. Das verbindet sie mit dem Schöpfer dieses Films, Adam Elliot. Er hat nämlich die gesamte Geschichte im Knettrick animiert. Ein kleines Team knetete an seiner Seite, aber alle Figuren, alle Hintergründe, alle Räume hat Adam Elliot selbst vorgeknetet; acht Jahre hat er damit zugebracht, die Memoiren einer Schnecke fertigzustellen. Mit dem Knettrick als solchem hat er sich schon seit Jahrzehnten befasst, für den Kurzfilm Harvie Krumpet erhielt er 2003 einen Oscar, sein erster Langfilm Mary & Max – oder: Schrumpfen Schafe, wenn es regnet? aus dem Jahr 2009 handelte von einem einsamen Mädchen in Melbourne, das eine Brieffreundschaft mit einem älteren Mann aus New York beginnt, der an Asperger-Autismus leidet. Memoiren einer Schnecke spielt wieder in Australien, in den 1970er-Jahren, in der Zeit der Kindheit des Regisseurs. Alles sei damals braun gewesen, sagt Elliot in Interviews, die Häuser, die Tapeten, die Interieurs, darum ist auch dieser Film ganz in Braun gehalten, die Schnecken sind braun, die Menschen sind braun, er sei zur Vorbereitung jahrelang damit beschäftigt gewesen, sagt Elliot, immer noch neue Arten und Schattierungen des Brauns zu finden.
Braun ist nicht gleich Braun, es gibt immer noch ein anderes Braun, und alles führt zurück in die Kindheit: Das sagt schon viel über die Kunst dieses Films. Er führt in eine Welt, in der es wimmelt und in der sich alles unaufhörlich verwandelt, auch dort, wo es eng und gedrückt erscheint; er führt in eine Welt, die voller Nuancen und Feinheiten ist, auch dort, wo man sie nicht erwartet oder nicht auf den ersten Blick sieht. Es ist eine Welt, die eigenen Gesetzen zu gehorchen scheint, die auf ihre eigene Weise atmet und schimmert und lebt – und der man doch in jedem Bild ansieht, dass es durch Handarbeit entstand. Alles wurde im Stop-Motion-Verfahren animiert, keine Computer kamen zum Einsatz, auf den Körpern der Figuren kann man noch die Abdrücke der knetenden Finger erkennen, alles ist in Bewegung – und zugleich roh behauen belassen beziehungsweise geknetet, an jedem einzelnen Bild lässt sich ablesen, dass es aus belebter Materie besteht.
Alles lebt, und zugleich ist alles von dem Wissen beseelt, dass man das Leben immer wieder von Neuem dem Tod abringen muss. Das verbindet Elliots Ästhetik mit seiner Geschichte. Grace überwindet ihre Einsamkeit mithilfe eines Mannes, von dem sie glaubt, dass er sie liebt – und wird von ihm auf tragische Weise enttäuscht; dafür trifft sie auf eine wundervolle ältere Frau, die ihre Begleiterin wird und die ihrerseits fantastische Geschichten erzählt – sie hat mit Fidel Castro Pingpong gespielt, und mit John Denver hatte sie Sex in einem Helikopter! (Warum John Denver, wurde Adam Elliot in einem Interview gefragt – weil er seine ganze Kindheit John-Denver-Songs hören musste, ist die Antwort, das muss reichen.) Aber auch die Fidel-Castro-und-John-Denver-Frau hat bald zu sterben, oder genauer gesagt: Sie ist schon immer tot; ihre letzten Atemzüge sieht man am Anfang des Films. Von dort aus erzählt Adam Elliot alles rückwärts und dann wieder vorwärts und in Sprüngen und Schleifen, und auf jeden Moment der Euphorie lässt er einen der Verzweiflung folgen, und auf jede Verzweiflung folgt wieder eine milde Ahnung von Hoffnung.
Am Anfang ist Grace Pudel mit ihren Schnecken ebenso allein wie am Ende, aber sie weiß, und sie wird immer schon gewusst haben, dass jedes Ende ein neuer Anfang ist und dass man nie für immer verlassen wird, weil die Zeit sich jedenfalls in ihrer Welt in verschiedene Richtungen gleichzeitig bewegt und weil jede Narbe, jede Wunde auf ihrem Körper zunächst und zuletzt nur der Abdruck eines gütig knetenden Schöpfers ist, der seine Figuren so liebt, dass er sich Jahre um Jahre in ihr Schicksal vertieft und sie schließlich dorthin führt, wo alle Kunst lebt und wohnt: ins Offene.