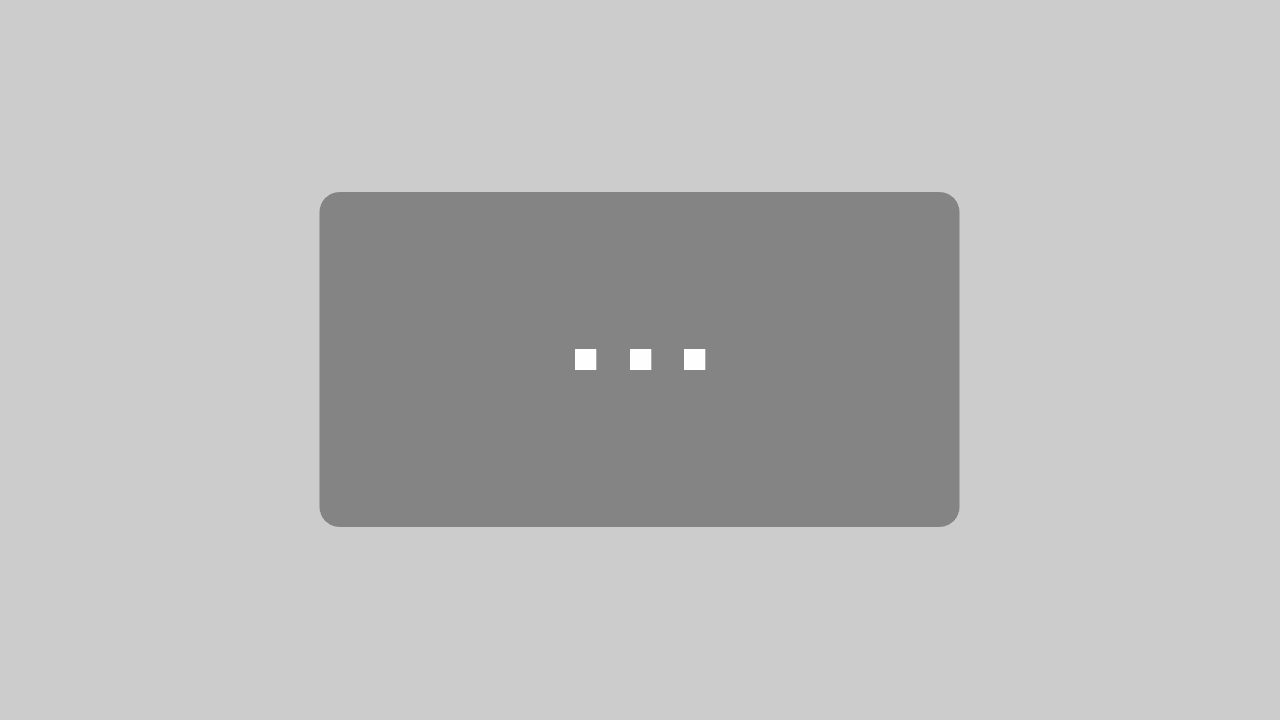Dokfilm & Gespräch: No Other Land
Palästinensische Autonomiegebiete/N 24, R: Yuval Abraham, FSK: 16, 93 min
Prädikat besonders wertvoll
Oscar für besten Dokumentarfilm
Berlinale – bester Dokumentarfilm
Im Anschluss laden wir zum Sofagespräch mit dem riesa efau – Kulturforum Dresden.
NO OTHER LAND ist ein kraftvoller Dokumentarfilm, der tief in den anhaltenden Konflikt und die Verdrängung im Westjordanland eintaucht. Der Film folgt dem palästinensischen Aktivisten Basel und dem israelischen Journalisten Yuval, die sich durch ihre gemeinsame Überzeugung, die Wahrheit ans Licht zu bringen, näherkommen, obwohl sie aus gegensätzlichen Welten stammen. Die Zerstörung von Masafer Yatta, einem kleinen palästinensischen Dorf, das seit Jahrzehnten dem ständigen Druck der israelischen Behörden ausgesetzt ist, steht im Mittelpunkt des Films. Der Dokumentarfilm fängt die rohe Realität des Lebens unter der Besatzung ein und beleuchtet die alltäglichen Kämpfe der palästinensischen Gemeinschaft, die mit der drohenden Zwangsräumung und der Zerstörung ihres Zuhauses konfrontiert ist.
Während Basel unermüdlich für das Überleben und die Rechte seines Volkes kämpft, versucht Yuval, die Komplexität des Konflikts durch seinen Journalismus zu vermitteln. Was als dokumentarische Erzählung über Zerstörung und Widerstand beginnt, entwickelt sich zu einer Geschichte über Menschlichkeit, Zusammenarbeit und die Möglichkeiten, die sich eröffnen, wenn Menschen über ideologische und politische Barrieren hinweg zusammenarbeiten. NO OTHER LAND zeigt, wie inmitten von Zerstörung und Leid unerwartete Bündnisse entstehen können, und fordert das Publikum auf, die Konflikte im Nahen Osten aus einer neuen Perspektive zu betrachten.
Die Filmarbeiten begannen 2018 und endeten kurz vor dem 7. Oktober 2023.
Sofagespräch „Vertrauen“
Im Rahmen des Seminars „Zeit zum Denken über Vertrauen – Niklas Luhmann“ veranschaulicht der Film eindrucksvoll, wie Vertrauen in gesellschaftliche Systeme unter Bedingungen struktureller Gewalt und politischer Ohnmacht nicht nur brüchig wird, sondern nahezu unmöglich erscheint. Herzlich willkommen zu einem angeregten Austausch!
Moderation: Denise Ackermann / riesa efau – Kulturforum Dresden

Eine Kooperation mit dem riesa efau – Kulturforum Dresden

Pressestimmen zum Film
No Other Land (Michael Meyns, Programmkino.de)
Seit 1967 hält Israel das Westjordanland besetzt, baut auch von der Bundesregierung als Völkerrechtswidrig bezeichnete Siedlungen und macht eine politische Lösung des Konflikts immer schwieriger. Welche Folgen diese Politik auf die Menschen im Westjordanland hat zeigt der betont ruhige, nichtsdestotrotz aufrührende, wütend machende Dokumentarfilm „No Other Land“, der bei der Berlinale mit dem Preis für den Besten Dokumentarfilm prämiert wurde.
Schon als Jugendlicher begann der palästinensische Aktivist Basel Adra sein Leben mit der Kamera zu dokumentieren, ein Leben, das von der israelischen Besatzung und ihrer oft haarsträubenden Folgen geprägt ist. Adras Heimat ist ein Zusammenschluss aus mehreren Dörfern, der als Masafer Yatta bezeichnet wird und im Süden des Westjordanlands liegt. Dort tobt ein erbitterter Streit zwischen den Palästinensern, die seit langer Zeit in diesen Dörfern leben und den Soldaten der israelischen Besatzungsmacht, die das Gebiet zum militärischen Sperrgebiet erklärt haben, wodurch das tägliche Leben der Palästinenser noch schwieriger wurde.
Immer wieder zerstört die israelische Armee Häuser der Palästinenser, die wiederum meist nachts versuchen, Schäden zu beheben und damit ihr Recht, hier zu leben, verteidigen. Eine Sisyphusaufgabe, denn die Mittel der israelischen Armee sind praktisch unbegrenzt, ihr Schutz durch israelische Gerichte groß und auch wenn nach dem Völkerrecht der Bau von Siedlungen auf besetztem Gebiet illegal ist, bleibt der Bau von immer mehr dieser Siedlungen im Westjordanland seit Jahrzehnten ohne Konsequenzen.
Auch manche israelische Journalisten und Aktivisten dokumentieren diese problematische Politik ihres Staates, darunter Yuval Abraham und die Kamerafrau Rachel Szor, die zusammen mit Adra und Hamdan Ballal das Autorenkollektiv bilden, die für den Dokumentarfilm „No Other Land“ verantwortlich zeichnen, der im Frühjahr bei der Berlinale seine Weltpremiere feierte, dort unter anderem mit dem Preis für den Besten Dokumentarfilm und mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde und seitdem auf zahlreichen internationalen Festivals gezeigt wurde.
Ob diese Aufmerksamkeit etwas an der katastrophalen Situation der Palästinenser im Westjordanland ändern kann mag man bezweifeln, zu hoffen wäre es. Im Kern zeigt „No Other Land“ zwar nichts Neues, aber genau das ist das Problem. Bilder von israelischer Willkür, der Zerstörung von Häusern, der zunehmenden Verzweiflung der Bewohner, den Schikanen an Checkpoints, die das Leben, den Versuch, irgendwo Arbeit zu finden, zu einer täglichen Tortur machen, kennt man aus allzu vielen Dokumentarfilmen und TV-Reportagen der letzten Jahre. Doch der internationale Druck auf Israel, sich endlich in Richtung einer für alle Seiten gerechten Zwei-Staaten-Lösung zu entwickeln steht und fällt je nach Lage der medialen Aufmerksamkeit und wird durch abscheuliche Taten wie das Massaker der Hamas im Oktober 2023 natürlich nicht befördert.
Dass den Filmemachern, vor allem dem Palästinenser Basel Adra nach der Preisverleihung bei der Berlinale massiver Hass entgegenschlug, es Morddrohungen gab, in manchen Kreisen in Deutschland unweigerlich auch der Vorwurf des Antisemitismus laut wurde, sollte nicht übersehen lassen, was „The Other Land“ im Kern darstellt: Einen betont nüchternen Blick auf eine verzweifelte Situation, die seit viel zu langer Zeit gärt und einer Lösung harrt. Hoffnung ist am Ende alles, was den Menschen im Westjordanland bleibt.
Die absolute Ausnahme (Lea Frehse, Die Zeit)
Die Doku „No Other Land“ bezieht Stellung gegen die Besatzung des Westjordanlands. Sie ist wunderbar schnörkellos – ganz im Gegenteil zu den Kontroversen um den Film.
Dieser Film ist roh, und er ist zart. Roh ist er in seinen Bildern, in der Art, wie er gefilmt wurde, mit Handkameras, und in dem, was er zeigt: die Zerstörung einer Dorfgemeinschaft im Westjordanland. Zart ist er in seinem Kern. Denn eigentlich, und dieser Eindruck wächst in einem beim Schauen wie beiläufig, handelt No Other Land gar nicht in erster Linie von Zerstörung und Gewalt. Sondern von der Frage, was wir diesen entgegenzusetzen haben. Wie man sich einander noch zuwendet, wenn viel größere Kräfte alle auseinandertreiben. Woran man sich festhält, wenn alles rutscht.
Damit ist dieser Film auch das Gegenteil von der Debatte, die sich in Deutschland schon an ihm entfachte, lange bevor er in die Kinos kam. No Other Land hatte seine Weltpremiere im Februar auf der Berlinale und wurde dort als bester Dokumentarfilm des Festivals geehrt. In ihren Dankesreden sprachen sich seine Regisseure, der Israeli Yuval Abraham und der Palästinenser Basel Adra, für ein Ende der israelischen Besatzung und „Apartheid“ (Abraham) und für den Stopp von deutschen Waffenlieferungen an Israel aus. Es folgte ein gewaltiger Shitstorm, angeführt von hochrangigen deutschen Politikern, die die beiden und ihren Film des Israelhasses und Antisemitismus bezichtigten. Abraham, dessen Vorfahren von Deutschen in Konzentrationslagern ermordet wurden, bekam in Deutschland und in Israel Todesdrohungen, seine Familie in Israel musste aus Angst vor rechtsextremen Mobs zeitweise untertauchen. Die deutsche Debatte zum Film war brutal, und sie war üppig ausgeschmückt mit Referenzen auf Staatsräson und vermeintlicher Moral. Sie stand sinnbildlich für die Schieflage im deutschen Diskurs zu Israel und Palästina insgesamt.
Und sie geht weiter. Jetzt, zum Kinostart, wurden dem Film in Inhaltsangaben einiger deutscher Stadtportale, darunter berlin.de, zunächst „antisemitische Tendenzen“ attestiert. Die meisten der Webseiten, die den Text offenbar von einem externen Dienstleister bezogen hatten, haben die Formulierung inzwischen gelöscht. Der Berliner Senat teilte dazu mit, die Veröffentlichung des ursprünglichen Textes sei „automatisiert“ erfolgt. Man habe den externen Dienstleister nach Hinweisen auf die Formulierung um Korrektur gebeten. Yuval Abraham schrieb bereits am Abend des 12. November auf X, dass er rechtlich gegen die zwischenzeitliche Einstufung von No Other Land vorgehen wolle.
Auch diese neuste Wendung in der Rezeption des Films zeigt: Es geht, was Israel und Palästina betrifft, in Deutschland richtig zur Sache, aber kaum je um die Sache. Dabei zeigt No Other Land doch genau diese. Die Kamera läuft an, und dann ist der Zuschauer einfach dabei. Beim gemeinsamen Rauchen nachts im Wohnzimmer. Auf der Fahrt durch die irre Landschaft nahe dem Toten Meer. Dabei, wenn die Armee-Bulldozer Häuser überrollen und auch beim tödlichen Schuss. Es ist der Alltag in Massafer Jatta, dem südlichsten Teil des Westjordanlands, den No Other Land dokumentiert. Die Gegend wurde vor Jahren schon von der israelischen Armee zum militärischen Übungsgebiet erklärt, ein Dutzend Dörfer und mehrere Tausend Palästinenser sollen weichen – während israelische Siedler, geschützt von ebendieser Armee, immer mehr Land beschlagnahmen. Es ist der alte Konflikt um Besatzung und Landnahme zwischen Israel und den Palästinensern, der sich hier abspielt. Neu und besonders ist an No Other Land, wie schnörkellos der Film zeigt, wo dieser Konflikt inzwischen wirklich steht. Denn in Massafer Jatta, eben weil es sehr weit abgelegen ist, zeigen sich die verschiedenen Akteure ganz unverhüllt.
Da stapfen militante Siedler, das Sturmgewehr im Anschlag, auf die Dörfler zu. Israelische Soldaten eskortieren sie. Da marschieren palästinensische und israelische Aktivisten zur Demonstration auf – und sind so wenige, ein paar Dutzend höchstens, vom Rest auch der palästinensischen Gesellschaft offensichtlich allein gelassen. Die ältesten Aufnahmen im Film zeigen Basel Adra, der in Massafer Jatta aufgewachsen ist und weiter dort lebt, wie er noch als Kind die ersten Zerstörungen seines Dorfes erlebt (das die Bewohner des Nachts dann immer wieder aufbauen). Es tritt dann Yuval Abraham in sein Leben, der jüdisch-israelische Aktivist im selben Alter, Ende 20, und es sind die wachsenden Bande des Vertrauens und der gemeinsam gerauchten nächtlichen Zigaretten, die dem Film seinen roten Faden geben. Er endet kurz nach dem 7. Oktober 2023 mit einem Schuss – und ist mit dieser Szene auch ein Jahr später von fast prophetischer Aktualität. Erstaunlich oft lässt einen No Other Land lächeln und dann zusammenzucken. Der Film ist ganz unmittelbar. Das ist seine große Stärke.
Die Unmittelbarkeit aber birgt auch eine gewisse Schwierigkeit, denn dem ausländischen Zuschauer, dem Israel-Palästina-Laien, wird nicht erklärt, wohin genau er sich durch die Kamera bewegt. Was diesen Szenen, die ihn zusammenzucken lassen, vorangegangen ist im jahrzehntelangen Konflikt. Und auch nicht, dass diese Bande des Vertrauens zwischen dem Israeli Abraham und dem Palästinenser Adra die absolute Ausnahme, eine wertvolle Seltenheit sind. Der Film steht klar auf der Seite der palästinensischen Dorfbewohner und ihrer israelischen Verbündeten – und ebenso klar gegen die militärische Besatzung. Wer ihnen und dieser Haltung skeptisch gegenübersteht, den holt No Other Land nicht ab. Die Bilder aus den Hügeln von Massafer Jatta aber werden sich allen Zuschauerinnen und Zuschauern einprägen.
In Israel und Palästina heißt das Westjordanland auch der Wilde Westen, weil es ein Grenzland ist, rau, zukunftsentscheidend, wo Recht das Recht des Stärkeren ist. Aber was dort abseits der Städte alltäglich vor sich geht, davon haben mehrheitlich weder Israelis noch Palästinenser ein echtes Bild. So haben Adra und Abraham diesen Film auch nicht in erster Linie – oder zumindest nicht ausschließlich – für ein ausländisches Publikum gedreht, sondern für die eigenen Leute. Und wissend, dass solch eine Arbeit bald schon unmöglich werden könnte. In Israel mit seiner ungestümen Kulturszene, wo Filme, auch sehr regierungskritische, bislang immer gefördert wurden, wird nicht nur das Geld dafür knapper, sondern es schrumpft auch der politische Raum wahnsinnig schnell. In Palästina gilt die Zusammenarbeit mit Israelis längst als schädliche „Normalisierung“ und manchen bereits als Verrat. No Other Land steht in einer Reihe mit früheren, auch sehr guten und erfolgreichen Dokumentarfilmen über die Besatzung, Emad Burnats und Guy Davidis Five Broken Cameras aus dem Jahr 2011 zum Beispiel. Aber etwas an ihm ist anders. Es geht weiter um Widerstand, nur jetzt im Angesicht der Niederlage.
Eine Szene mitten im Film fällt aus dem Format. Abraham und Adra sind im Auto unterwegs, es ist Nacht. Die Kamera, die sie filmt, ist am Rückspiegel montiert, was zunächst den Eindruck erweckt, das folgende Gespräch sei geplant oder gestellt. Es wirkt dann aber sehr echt. Abraham, der Israeli, ist frustriert, seine Arbeit scheint nicht zu fruchten, Videos, die er veröffentlicht, werden kaum geklickt. „Du willst alles in zehn Tagen lösen und nach Hause gehen“, entgegnet Adra ihm. „Du wirst dich noch ans Verlieren gewöhnen.“ Perfekt fängt dieser Moment die Stimmung ein, die das Westjordanland beherrscht. Die Zermürbung, die Rage und die vielen offenen Fragen dazwischen, die es alle auszuhalten gilt. Es sind diese Momente des Innehaltens und diese Fragen, wegen derer man den Film schauen sollte. Die Momente und Fragen, die der deutschen Debatte so außerordentlich fehlen.
Anfeindungen wegen „No Other Land“: Mancher redet nicht mehr mit ihm
(Maria Sterk, Frankfurter Rundschau)
Die Kluft könnte kaum größer sein: Als der frisch prämierte israelische Journalist und Filmemacher Yuval Avraham auf der Bühne der diesjährigen Oscar-Zeremonie für einen Kurswechsel in Israel und Palästina plädierte, klatschte das Publikum vor Ort enthusiastisch. Zuhause im Neun-Millionen-Land Israel hingegen hielt sich die Begeisterung über die Auszeichnung zum besten Dokumentarfilm, die „No Other Land“ soeben zuteilgeworden war, in bescheidenen Grenzen.
„Ein trauriger Moment in der Welt des Films“ sei die Auszeichnung, sagte Kulturminister Miki Zohar. Die Doku, die aus nächster Nähe die systematischen Vertreibungen palästinensischer Bauern aus ihren Dörfern im Westjordanland festhält, sei ein Mittel zur „Sabotage des Staates Israel“, meint der Minister. „Freie Meinungsäußerung ist ein wichtiger Wert“, so Zohar zwar – in diesem Fall gehe es aber eher darum, sich international hervorzutun, indem man Israel schlechtmache.
In Israel trägt das wohl eher dazu bei, den Film einem größeren Publikum wenigstens vom Namen her bekannt zu machen. Während „No Other Land“ zuvor bereits in mehreren Festivals ausgezeichnet wurde und unter anderem auf der Berlinale zum besten Dokumentartfilm prämiert worden war, gab es ihn hier noch in keinem Kino regulär zu sehen. Die Hälfte des israelisch-palästinensischen Filmemacher-Teams dürfte aber auch gar nicht anreisen, sollte der Film etwa in Jerusalem oder Tel Aviv in den Kinos laufen. Auch zur Oscar-Verleihung mussten die Filmemacher auf unterschiedlichen Wegen anreisen: Yuval Avraham und Rachel Szor flogen in Tel Aviv ab, Basel Adra und Hamdan Ballal mussten den Umweg über das jordanische Amman nehmen.
Zwei Tage vor seiner Abreise in die USA stand Avraham in einem kleinen, alternativen Veranstaltungsort in Jerusalem Rede und Antwort. Auf die Frage, ob der Film etwas geändert habe an den gezielten Vertreibungen der Familien aus Masafer Yatta, einem Siedlungsgebiet südlich von Hebron im Westjordanland, sagt Avraham: „Es ist nicht nur nicht besser geworden. Es ist sogar noch viel schlimmer als damals.“
Rund tausend Menschen leben in Masafer Yatta in kleinen Gemeinden, sie züchten Schafe, bauen Gemüse und Oliven an. Hier hat Israels Armee in den 1980er Jahren eine Truppenübungszone errichtet, weil die hügelige Landschaft der Topografie dem Süden des Libanon ähnelt. Geübt wurde dann aber nicht. Nun sind die Menschen in Masafer Yatta laufend Bedrohungen ausgesetzt – entweder durch die Armee, die Häuser, Schulen und Ställe abreißt, oder aber durch gewaltbereite Siedler-Gangs, die durch die Dörfer marschieren. „No Other Land“ dokumentiert ihr Schicksal.
Es ist aber auch ein Film über Freundschaft in Zeiten politischen Konflikts. Die Filmemacher Yuval Avraham und Basel Adra sprechen darin darüber, wie die Realität im besetzten Westjordanland auch ihre Beziehung zueinander belastet: Avraham kann nach einem Tag der dokumentierten Menschenrechtsverletzung wieder nachhause ins warme Bett zurückkehren. Adra hingegen ist selbst einer der Menschen, deren Rechte verletzt werden – und neben seinem Bett liegt die Kamera, mit denen er vielleicht in der kommenden Nacht ausrücken muss, um herannahende Bulldozer zu filmen.
„Filmen und Demonstrieren – das sind die Werkzeuge, die den Bewohnern und Bewohnerinnen bleiben, um sich zu wehren“, sagt Avraham. „Sonst würden sie nur dasitzen und mitzählen, wie viele Häuser abgerissen werden.“ Auf die Frage, ob auch er selbst Repression ausgesetzt sei, sagt Avraham: „Ich zahle meinen Preis eher im sozialen Umfeld.“ Manche seiner Freunde würden nicht mehr mit ihm reden. Und nach der Auszeichnung in Berlin musste Avrahams Mutter für einige Tage aus ihrem Haus flüchten, weil sie von rechten Hetzern bedroht worden war.