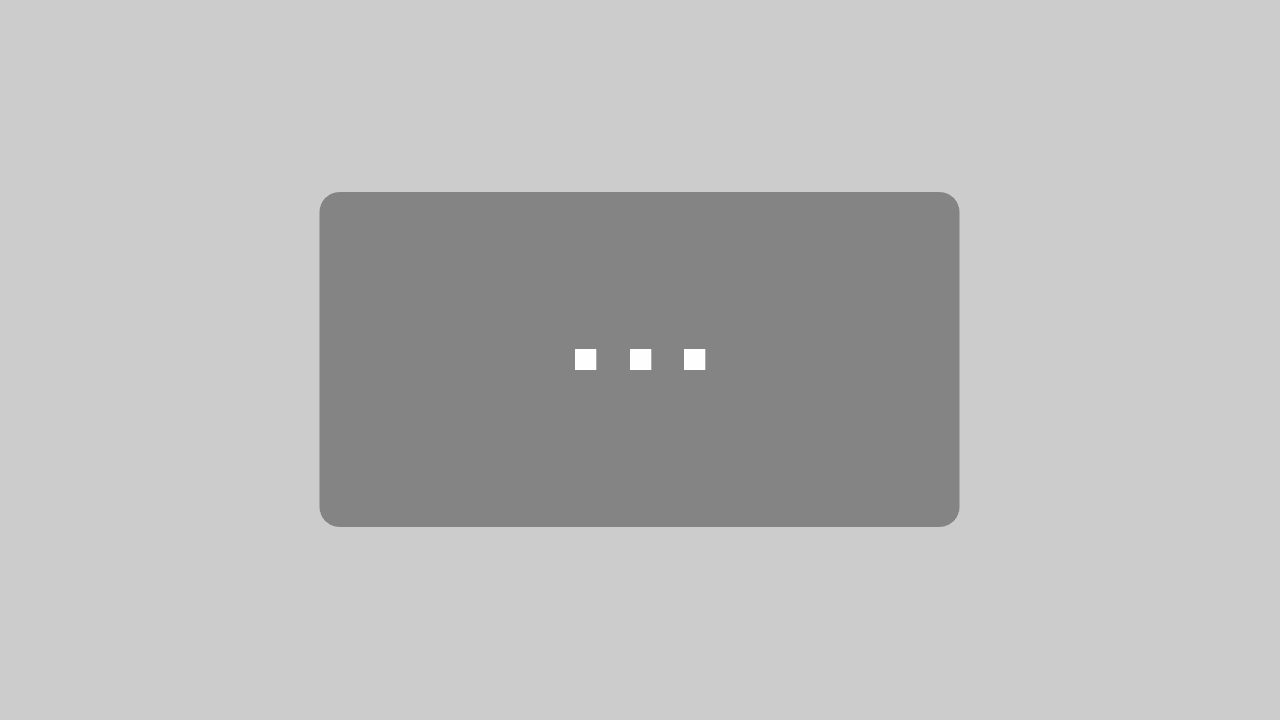Was ist schon normal?
F 24, R: Artus, FSK: 6, 100 min
Nach einem Raubüberfall flüchten Paulo (Artus) und sein Vater (Clovis Cornillac) vor der Polizei und finden ausgerechnet Unterschlupf in einem Reisebus, der junge Erwachsene mit Behinderung an ihren Urlaubsort in die Berge bringen soll. Paulo und sein Vater geben sich kurzerhand als der fehlende Mitreisende Sylvain und dessen Betreuer aus – eine fast perfekte Tarnung. Mit der Flucht vor der Polizei beginnt ein außergewöhnliches Abenteuer, das alle Beteiligten vor ungeahnte Herausforderungen stellt – jede Menge Spaß, neue Freundschaften und viel Herz inklusive.
Der Film läuft auch am Mi 18.12. | 19:30 Uhr im Kronenkino Zittau.
Pressestimmen zum Film
Was ist schon normal?
Michael Kienzl, Filmdienst
Warmherzige Komödie um zwei Juwelendiebe, die sich auf der Flucht vor der Polizei unter eine Gruppe behinderter Menschen mischen.
Vor dem alljährlichen Ausflug ins Ferienlager für behinderte Menschen versuchen die Betreuer das Chaos zu bewältigen. Doch schon der Gang zum Bus erweist sich mit den eigensinnigen Teilnehmern als erstes Hindernis. In einer ähnlichen Aufregung befinden sich der Räuber Paul (Artus) und sein Vater La Fraise (Clovis Cornillac), die unweit davon ein Juweliergeschäft ausräumen. Ein abgeschleppter Fluchtwagen bringt die beiden Geschichten schließlich zusammen.
Um sich vor der Polizei zu verstecken, gibt sich Paul als behindert aus und La Fraise als sein Pfleger. Die List gelingt, und die beiden schließen sich der Reisegruppe an. Aber schon das Schmierentheater, das Paul mit denkbar stereotyper Mimik veranstaltet, zeigt, wie unterschiedlich die Welten sind, die hier aufeinanderprallen.
Mit rustikalem Humor
Für das Regiedebüt des Komikers Artus sind es gerade die Gegensätze, die zum Fundus des rustikalen Humors werden. Die Kriminellen sind plötzlich mitten in der Provinz gefangen, wo sie sich sichtlich unwohl fühlen. Peinliche Situationen zwischen Paul und dem überfürsorglichen Betreuer Marc (Marc Riso) sorgen ebenso wie die bröckelnde Fassade des cholerisch-unsensiblen La Fraise für einige Lacher.
Freilich wird Paul von seinen Mitbewohnern schnell als Betrüger entlarvt und auch gleich fürs Rückenschrubben erpresst. Doch der gegenseitige Umgang gewinnt bald freundschaftliche Dimensionen, wenn der smarte Arnaud (Arnaud Toupense) Paul zu mehr Feinheiten bei seiner Maskerade verhilft oder sich im Gegenzug helfen lässt, seine heimliche Liebe Marie (Marie Colin) zu beeindrucken. Der griesgrämige La Fraise entwickelt währenddessen einen besonderen Draht zu dem jungen Fußballfan Baptiste (Théophile Leroy).
Die Unterschiede treten zurück
Mit zunehmender Dauer lässt „Was ist schon normal?“ die Unterschiede in den Hintergrund treten und betont das Verbindende. Artus setzt dabei auf typisierte Figuren und ein paar Flachwitze, vermeidet es meistens aber, die behinderten Darsteller in ihren Rollen zu bevormunden oder zu verniedlichen. Abgesehen von dem zum reinen Kuriosum getrimmten Crossdresser Boris (Boris Pitoëff) oder dem sich lediglich über seine Kippa definierenden Gad (Gad Abecassis) hat man es mit eigenständigen, exzentrischen Persönlichkeiten zu tun. Der Film schätzt vor allem das anarchische Potenzial seiner körperlich und geistig eingeschränkten Figuren. Stur, nur bedingt diszipliniert und mit einem Hang zu Kraftausdrücken lehnen sie sich immer wieder gegen das Reglement auf.
„Was ist schon normal?“ versucht das Dilemma der wohlmeinenden, aber hoffnungslos überarbeiteten Betreuer ebenso zu fassen wie das ihrer häufig von stupiden Aufgaben unterforderten Schützlinge. Letztlich geht es für alle darum, aus festgefahrenen Strukturen auszubrechen. Stellvertretend dafür steht der Running Gag, dass jeden Tag derselbe unappetitliche Matsch zum Essen serviert wird, abwechselnd als Lasagne und Moussaka betitelt.
Alle wollen geliebt sein
Statt auf Kontraste setzt Artus auf fließende Übergänge. Die waffenvernarrte Betreuerin Céline (Céline Groussard) wird mit dickem Pinsel als so durchgeknallt und unberechenbar gezeichnet, dass man ihr am liebsten selbst einen Pfleger an die Seite stellen möchte. Man erkennt die Absicht hinter solchen etwas plumpen Drehbuchtricks, aber das fällt nicht sonderlich ins Gewicht. Wenn der Film mit fortschreitender Laufzeit ins Herz zielt, versucht er die Unterschiede vollends aufzulösen. Das zerrüttete Vater-Sohn-Verhältnis der Räuber spiegelt sich dann in den Erzählungen der Behinderten wider, die von ihren Angehörigen oft aufs Abstellgleis gestellt wurden. Am Ende wollen alle nur geliebt und geschätzt werden.
Paul hat es auf die Betreuerin Alice (Alice Belaïdi) abgesehen, die ihrerseits zwischen der Leidenschaft für ihren Beruf und einem neuen Leben samt oberflächlichem Gatten im Ausland hin- und hergerissen ist. Leidenschaft und Menschlichkeit werden gegen Pflichtbewusstsein und Bürokratie verteidigt. Gegen Ende wird es manchmal doch zu sentimental. Mit Bildern von lachenden Gesichtern in Zeitlupe und Chansons von Dalida versucht Artus etwas sehr vehement, eine Wohlfühl-Atmosphäre zu erzwingen. Die Versöhnlichkeit, in der sich die Geschichte schließlich auflöst, zelebriert der Film aber durchaus mit emotionaler Wucht.
Die mit dem Extra-Ding
Kira Taszman, TAZ
In Frankreich ist der Film „Was ist schon normal?“ ein Riesenerfolg. Zum Ensemble der klamottigen Komödie gehören viele Menschen mit Behinderung.
Alle Jubeljahre kommt in Frankreich ein scheinbar unscheinbarer Film in die Kinos, der nicht nur ein riesiger Kassenhit wird, sondern auch in Kultur und Sprache eingeht. 2008 war es „Willkommen bei den Schti’s“, der insgesamt etwas über 20 Millionen Zuschauer anzog, und im Jahr 2011 „Ziemlich beste Freunde“ mit über 19 Millionen Zuschauern. Beide waren Komödien, beide stellten Protagonisten in den Mittelpunkt, die selten auf der Leinwand zu sehen sind, und räumten mit Vorurteilen auf.
So entpuppten sich die nordfranzösischen Schti’s, die „komisch“ reden, weil sie alle Zischlaute in ein „sch“ verwandeln, weniger als vertrottelte Provinzler denn als umgängliche Mitmenschen. In „Ziemlich beste Freunde“ wiederum saß der weiße Bourgeois Philippe im Rollstuhl und entdeckte durch seinen unkonventionellen schwarzen Pfleger Driss aus der Banlieue die Welt wieder neu. Lachen durfte man in beiden Filmen mit und über die „Anderen“, weil sich ihre Andersartigkeit als Projektion von außen herausstellte.
Ähnlich verhält es sich nun auch mit der neuesten Erfolgskomödie aus Frankreich, die den wenig originellen deutschen Verleihtitel „Was ist schon normal?“ trägt. Sie überschritt Mitte August die magische Zuschauermarke von 10 Millionen und füllt so in Zeiten von Kinomüdigkeit und Streamingdiensten die Kinosessel.
Der französische Originaltitel „Un p’tit truc en plus“ verweist auf das Chromosom 21, das bei Menschen mit Downsyndrom nicht zweimal, wie bei den meisten Menschen, sondern dreimal vorhanden ist. Es handelt sich also, um den Titel wörtlich zu übersetzen, um „ein kleines Extra(-Ding)“. Zwei Ganoven werden im Laufe des Films viel mit Menschen mit diesem „Extra-Ding“ zu tun haben.
Der Film
„Was ist schon normal?“. Regie: Artus. Mit Clovis Cornillac, Alice Belaïdi u. a. Frankreich 2024, 99 Min.
Alles beginnt in dem Film von Artus, der sich mit seinem Künstlernamen wirklich nur so nennt und hier als Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler agiert, mit einem Raubüberfall auf einen Juwelierladen. Paulo (Artus) und sein Vater La Fraise (Clovis Cornillac) erbeuten wertvollen Schmuck und türmen dann. Sie landen vor einem Reisebus voller „Downies“ und anderer Menschen mit Behinderungen, die auf dem Weg zu ihrer Urlaubsunterkunft im Vercors-Gebirge sind.
„Downies“ und „Normalos“
Paulo gibt sich als geistig behindert aus und La Fraise mimt den Betreuer. Fortan nennen sie sich Sylvain und Orpi und freuen sich, die Polizei abgehängt zu haben. Paulo gelingt die Interaktion mit seinen Reisekumpanen ziemlich gut. Sie durchschauen zwar schnell sein Cover, halten aber dicht und nehmen ihn in ihrer Gemeinschaft auf.
Im Ferienort gibt es Scherereien mit dem Besitzer des Grundstücks, und die Caterer vor Ort speisen die Urlauber mit dürftiger Kost ab. So schwingt sich La Fraise mit teilweise rabiaten Methoden zu ihrem Beschützer auf. Der Film erzählt zwei Geschichten parallel: die der untergetauchten Kleingangster, die ihre Beute verticken müssen, und die der Truppe mit dem „Extra-Ding“, den eigentlichen Helden des Films. Deren Bedürfnisse in den malerischen Bergkulissen Südostfrankreichs unterscheiden sich eigentlich kaum von denen der „Normalos“.
Der Film setzt auf Running Gags, Situationskomik, Pimmel- und Kacka-Witze. Doch hat er auch sein Herz am rechten Fleck
Sie haben Vorlieben und Abneigungen – so schwärmt Arnaud (Arnaud Toupense) virtuell für die (verstorbene) Schlagerikone Dalida und in echt für Marie (Marie Colin), die ebenfalls das Downsyndrom hat, während Baptiste den Fußballstar Cristiano Ronaldo verehrt. Die festgefahrenen Abläufe im Feriencamp langweilen Arnaud, Marie, Thibaut, Boris und die restlichen Heimbewohner. Ständig werden sie von den „Normalos“ unterschätzt. Zwar kommt die Komödie einigermaßen klamottig herüber, setzt auf Running Gags (Marie bekommt immer versehentlich eines auf die Nase), Pimmel- und Kacka-Witze oder Situationskomik. Doch der Film hat sein Herz am rechten Fleck und optiert im Zweifel immer für die sogenannten Beeinträchtigten.
Die Hauptrollen werden außer dem Kleingangsterduo und den Betreuern von echten Menschen mit Downsyndrom, von Autisten und Gehbehinderten gespielt, und sie erhalten deutlich mehr Leinwandzeit als in Filmen mit ähnlichem Sujet. In Cannes stieg das Filmteam sogar die berühmten Stufen des Festivalpalais empor. Doch dass namhafte Designer die Schauspieler:innen zunächst nicht einkleiden wollten und sich in Ausreden flüchteten, zeigt, dass im echten Leben noch einiges im Argen liegt für den Umgang mit Menschen mit dem „P’tit truc en plus“.